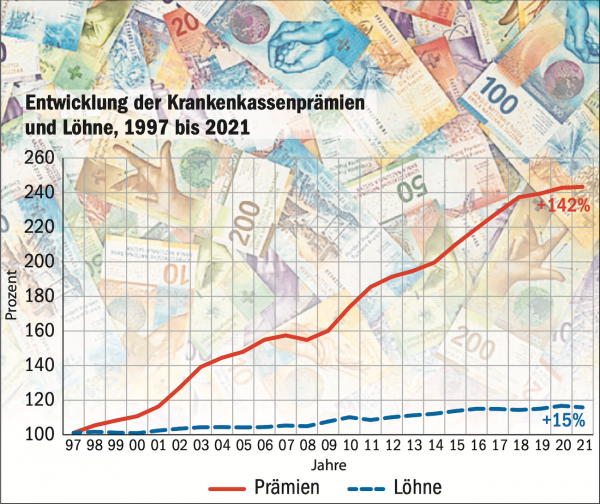Unia-Industriechef Yves Defferrard (57) über Trophäen, Teuerung und tatenlose Politik«Es braucht eine Industrieministerin!»
Für Yves Defferrard ist klar: die Industrie-Patrons haben eine Chance verpasst, die Branche für Fachleute attraktiver zu machen. Im grossen work-Interview erklärt der Unia-Industriechef, wie es dazu kam.