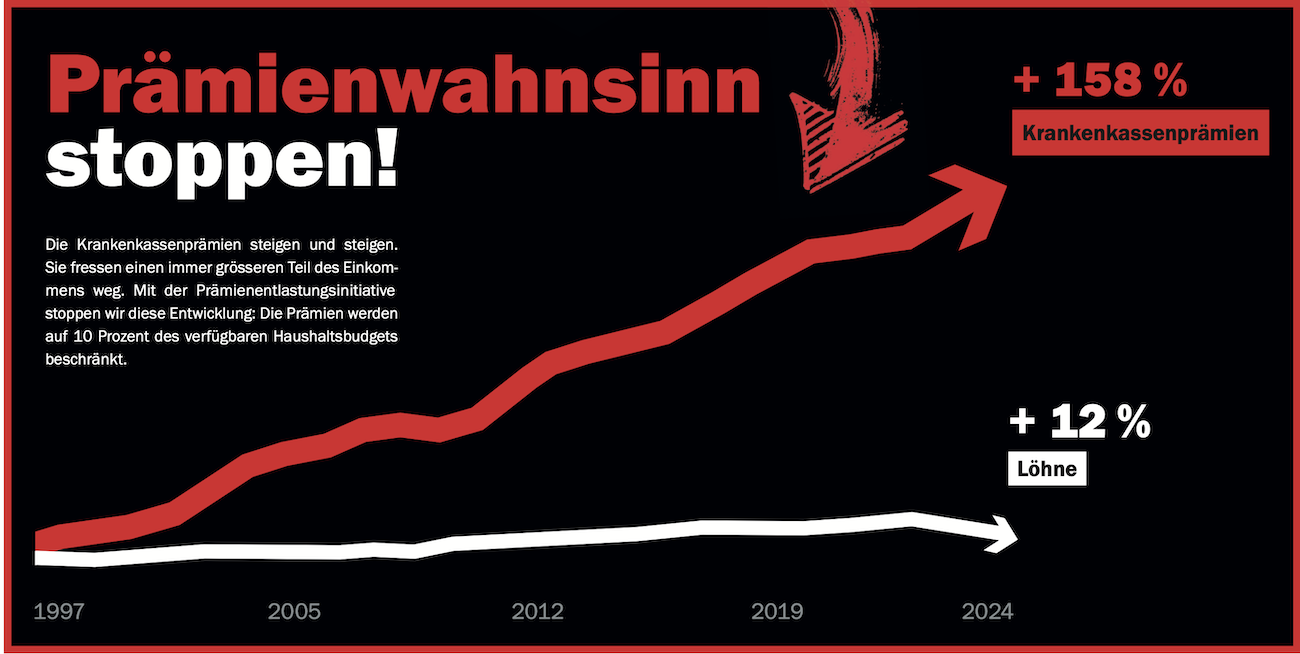Der Corona-Virus macht medizinisch keinen Unterschied zwischen den Klassen. Aber die soziale Lage der Klassen bestimmt, wie die Menschen durch die Krise kommen: gesundheitlich und ökonomisch.

DER REST BLEIBT DRAUSSEN: Wie im Arche-Noah-Märchen haben in der Corona-Krise nicht alle Zugang zu rettenden Massnahmen. (Kaspar Memberger: Einzug der Tiere in die Arche Noah (1588). Öl auf Leinwand, 125,5 × 163 cm. © AKG-IMAGES.de)
Jede Krise spült Worte in den allgemeinen Sprachgebrauch, die vorher nur in eingeschränkten Milieus gebräuchlich waren. Das Schweizer Corona-Wort ist: nein, weder «Herdenimmunität» noch «Durchseuchung» – sondern «vulnerabel», also verwundbar oder verletzbar. Gemeint sind damit alle jene Menschen, die besonders gefährdet sind, wenn sie den Virus einfangen. Weil sie für eine Infektion besonders anfällig sind und weil die Krankheit bei ihnen besonders schwer verläuft. Bis hin zum Tod.
Die gesundheitlichen Risikogruppen beim Corona-Virus sind Menschen über 65 Jahre mit oder ohne Vorerkrankung. Plus alle Menschen unter 65 Jahre mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, chronischen Atemwegserkrankungen (zum Beispiel Asthma), Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ebenfalls eine Risikogruppe sind Krebskranke und Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Laut offiziellen BAG-Zahlen sind das in der Schweiz 2’602’000 Menschen. Das sind fast 30 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner. Alle sie wollen die SVP und Wirtschaftsverbände einsperren oder «opfern», damit ihre Profite wieder stimmen.
WELCHE SOLIDARITÄT?
«Vulnerabel» ist aber nicht bloss eine Vokabel aus der Medizin. «Vulnerabel» gibt es auch gesellschaftlich und ökonomisch. Es ist viel von Solidarität die Rede in diesen Tagen. Und es gibt viele Angebote von unten, in der Nachbarschaft, in den Quartieren. Das macht Hoffnung und ist eine Stärkung der Zivilgesellschaft. Und viele sagen, dass wir alle gleich seien vor dem Virus. Wir hören viele Appelle zum «Zusammenhalt» in schwierigen Zeiten. Auch das ist in Ordnung. Aber nein, nicht alle sind vor dem Virus gleich. Und nein, nicht alle sind von den Massnahmen zur Virusbekämpfung im gleichen Ausmass betroffen. Und nein, «wir sitzen nicht alle im gleichen Boot». Auch in Corona-Zeiten gibt es einige wenige, die da sitzen, während die Mehrheit rudert. Und viele kommen gar nicht erst ins Boot und ersaufen im Mittelmeer. Wer bereits vor Corona sozial und ökonomisch ausgegrenzt war, kann sich «social distancing» nicht leisten. Geringverdienende, prekär Beschäftigte, Obdachlose, Suchtmittelabhängige, sonst Abgehängte waren schon vorher «sozial distanziert» und sind es jetzt erst recht.
BEISPIEL 1
Die Schulen sind geschlossen. Das ist vernünftig. Die Lehrkräfte haben Home-Schooling-Programme auf die Beine gestellt. Das ist gut. Und klappt alles irgendwie in der nicht mehr ganz so neuen digitalen Welt. Vorausgesetzt, die Infrastruktur ist vorhanden. Das ist allerdings besonders für jene unmöglich, die schon vor Corona die nötigen Geräte nicht anschaffen konnten. Gering- und Mittelverdienende haben oft schlicht nicht für jedes Kind einen Laptop. Haushalte in prekären Verhältnissen haben gar keinen. Home-Schooling ist für alle eine Herausforderung, aber für jene erst recht, für die das Leben generell eine ökonomische Herausforderung ist. Kinder in engen und beengenden Wohnverhältnissen und mit Eltern, die sich um die schulische Betreuung ihrer Kinder nicht kümmern können, haben es zusätzlich schwer. Und diese Eltern können sich nicht kümmern, weil ihnen die Sprachkompetenz fehlt. Zum Beispiel. Oder weil sie zur Arbeit müssen, um wenigstens das kleine Einkommen zu retten.
BEISPIEL 2
In den vergangenen Jahren ist in der Schweiz der Bereich der prekär Beschäftigten gewachsen. Von der marktradikalen Ideologie propagandiert und von der rechten Mehrheit in der Politik getrieben. Unter dem Vorwand der «Missbrauchsbekämpfung» haben sie riesige Löcher ins soziale Netz gerissen. Die Folge davon: Zehntausende von Menschen, die nur äusserst knapp über die Runden kamen – bereits vor der Corona-Pandemie. Zum Beispiel Beschäftigte in Tieflohnbranchen. Sie arbeiten häufig im Stundenlohn, in Arbeit auf Abruf oder als (Schein-)Selbständige mit knappen Reserven. Sie alle sind jetzt erst recht mit akuten Existenzfragen konfrontiert – bis hin zur Frage, was denn bei ihnen überhaupt noch auf den Tisch komme. Im schlechten Fall gehen sie arbeiten, ohne dass der Gesundheitsschutz gewährleistet ist. Im schlechtesten Fall verlieren sie das sowieso knappe Einkommen vollends.
In der Schweiz sind nach den neusten verfügbaren Zahlen (2018) 660’000 Menschen armutsbetroffen. Darunter auch 135’000 Working Poor. Also Frauen und Männer, die trotz Lohnarbeit arm sind. 1,16 Millionen Menschen sind armutsgefährdet. Das heisst: sie verdienen deutlich weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung. Für sie ist die aktuelle Lage nicht «Entschleunigung», sondern zusätzlicher Existenzstress.
BEISPEIL 3
Besonders «vulnerabel» sind auch all jene Gruppen, die schon im gesellschaftlichen Normalbetrieb definitiv rausgedrängt sind: zum Beispiel Obdachlose, Abhängige und Sans-papiers. Viele Hilfsangebote wurden wegen der Corona-Krise eingestellt. Weil die geforderten Abstandsregeln nicht einzuhalten sind. Genauso wenig wie in den Asylzentren mit ihren Massenschlägen und – je nach Kanton – rigorosen Ausgangsregeln. Für Drogenabhängige in Gegenden ohne niederschwellige Stoffabgabe wiederum werden die Substanzen wegen der Grenzabriegelung knapp, die Preise steigen – und gleichzeitig fallen die wenigen Einnahmequellen weg. Betteln am Bahnhof zum Beispiel, wenn keine Pendlerinnen und Pendler unterwegs sind?
Drogenabhängige, Asylbewerbende und Sans-papiers haben unter pandemiefreien Umständen die Gabe, sich in den Menschenmengen zu bewegen wie Fische im Wasser. Unauffällig und auf der Hut. Das ist in leergefegten Städten nicht mehr möglich. Sie laufen ständig in Gefahr, einer der Polizeistreifen in die Arme zu laufen, die den öffentlichen Raum derzeit prägen. Für die einen ist das «bloss» zusätzlicher Stress, für die anderen geht es um Festnahme und Abschiebehaft.
BEATMUNGSGERÄTE
Bei schweren Verläufen müssen Patientinnen und Patienten, die an Corona erkrankt sind, auf der Intensivstation behandelt werden. In der Schweiz (Bevölkerung: rund 8,6 Millionen) gibt es derzeit rund 1000 solcher Intensivplätze mit Beatmungsgeräten. Der Bund hat inzwischen weitere 900 Geräte bestellt. In Afrika (Bevölkerung: knapp 1,3 Milliarden) gibt es nach Expertenschätzungen im besten Fall 500 Beatmungsgeräte. Im griechischen Flüchtlingslager Moria (ausgelegt für 3000 Menschen) drängen sich 20’000 Frauen, Kinder und Männer auf engstem Raum. 1300 Menschen teilen sich einen Wasserhahn. Abstand halten, zu Hause bleiben, Hände waschen und desinfizieren – völlig unmöglich!
Genauso wie in den Armenvierteln in Afrika, Süd- und Mittelamerika und Asien. Während sich die Reichen in Sicherheit bringen, hat die Mehrheit die zynische Wahl, sich dem Virus auszusetzen oder zu verhungern. In den USA unter Amok-Präsident Donald Trump explodieren die Ansteckungs- und Todesfälle. Überdurchschnittlich vertreten unter den Opfern sind Afroamerikanerinnen und -amerikaner, Natives und Latinos. Diese Gruppen leben auch überdurchschnittlich häufig unter schlechten ökonomischen Verhältnissen.
AUFSTÄNDE
In mehreren Regionen, die besonders von prekären ökonomischen Verhältnissen geprägt sind, kam es bereits zu Aufständen und widerständigen Selbsthilfeaktionen. Denn was die rechten Parteien und die Wirtschaftsverbände in der Schweiz fordern, setzt die Rechte international bereits in grossem Stil um. Ihr Motto heisst «Opfert die Schwachen!» Doch die wehren sich, wo sie können, wenn sie noch können. Zum Beispiel in Süditalien, wo hungrige Landarbeiterinnen und Landarbeiter Supermärkte plündern. Oder in Marseille, wo McDonalds-Angestellte «ihre» Filiale zu einem Verteilzentrum für Lebensmittelspenden umfunktioniert haben. Oder in Südafrika, wo Schwarze gegen die ungenügende Lebensmittelhilfe protestieren – trotz brutalem Vorgehen der Sicherheitskräfte. Selbst der Internationale Währungsfonds (IWF) – eigentlich jeglicher Sozialstaatfreundlichkeit unverdächtig – warnt unterdessen vor «neuen Protesten», wenn die Unterstützung wegen der Pandemiemassnahmen allzu mickrig ausfällt.
ERKENNTNIS 1
Der neuartige Corona-Virus macht medizinisch keinen Unterschied zwischen den Klassen. Aber die soziale Lage der Klassen bestimmt, wie die Menschen durch die Krise kommen: gesundheitlich und ökonomisch.
ERKENNTNIS 2
Solidarität ist wichtig. Aber sie darf sich nicht auf Nachbarschaftshilfe beschränken. Es braucht mehr. Und zwar eine tiefgehende Änderung der gesellschaftlichen und ökonomischen Organisation. Regional, national und global. Das herrschende System kommt mit der Herausforderung der Pandemie mehr schlecht als recht zurecht (siehe Seite 13).
ERKENNTNIS 3
Die Corona-Krise ist zwar eine medizinische Krise. Aber ihre Folgen zeigen die Krise des Kapitalismus. Er ist einmal mehr entzaubert!
Medienkonzerne Hohle Hand und Dividenden
Vor 12 Jahren musste der Staat die UBS retten. Die hatte sich im internationalen Finanzcasino massiv verzockt. Und war darüber hinaus kriminell unterwegs. Rund 60 Milliarden Franken warfen Bund und Nationalbank für das Überleben der UBS auf. Kaum war das Volksvermögen zur Grossbank umgeleitet, mahnten die publizistischen Sprachrohre der Finanzindustrie, es müsse jetzt mit der «staatlichen Einmischung» genug sein. Die Banker sollen wieder fuhrwerken können, wie sie lustig sind.
NZZ & TA. Aktuell stützt die öffentliche Hand die Wirtschaft in der Corona-Krise – leider noch längst nicht alle Bereiche und Branchen. Der Staat muss das tun, weil «der Markt» versagt. Und noch mitten in der Krise (aber nachdem ein als KMU-Hilfspaket verkauftes Banken- und Immobilienkonzern-Unterstützungspaket aufgegleist war) kommen schon wieder die Marktradikalen um die Ecke. Sie schreiben «genug jetzt» oder warnen vor «Seuchen-Sozialismus» (O-Ton NZZ-Chef Eric Gujer). Bemerkenswert: Ausgerechnet die Medien jener Konzerne (NZZ und Tamedia) sind am lautesten, die aktuell beim Bund um Dutzende Millionen betteln, sich unterdessen Teile ihrer Lohnkosten als Kurzarbeit von der Allgemeinheit finanzieren lassen – und gleichzeitig Dividenden ausschütten.