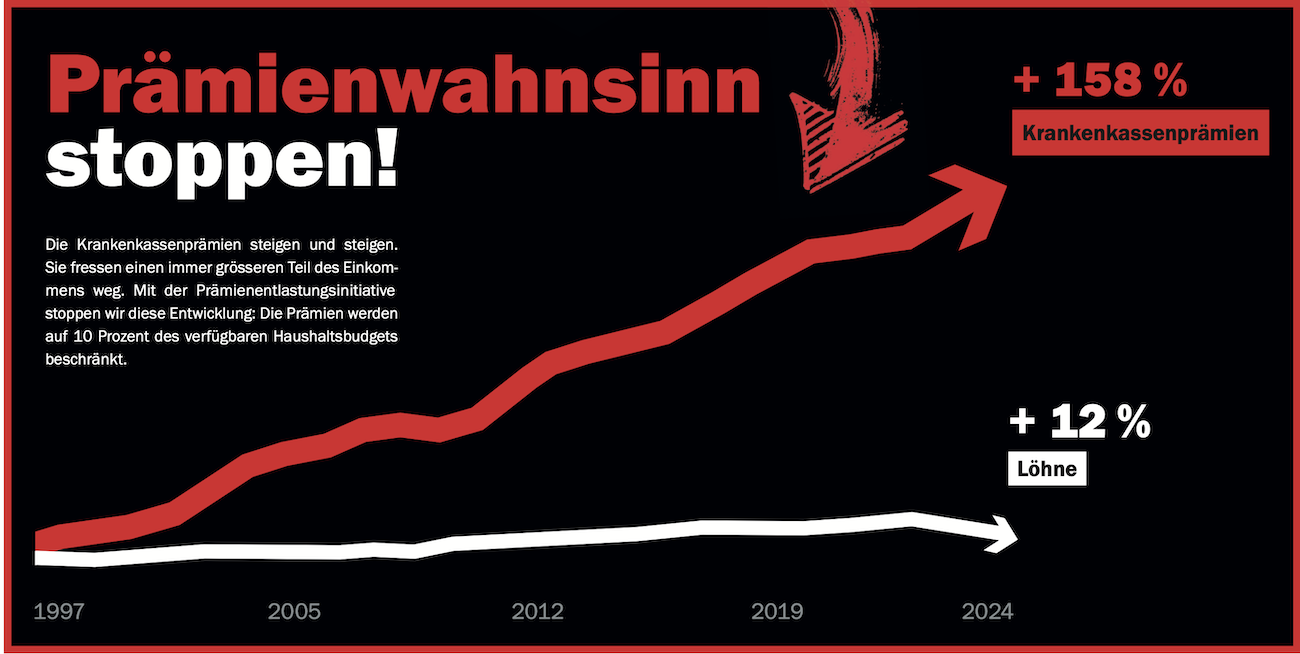Wahnwitzige Geschäfte mit irren Finanzjongleuren, Milliardenverluste, Köpferollen: Ist der neueste Credit-Suisse-Krimi das Startsignal zur nächsten Finanzkrise?

BAUERNSCHLAU: Der australische Farmerssohn Alex Greensill blies ein einfaches Geschäftsmodell zur Finanz-Maschine auf. Die Credit Suisse frass ihm aus der Hand – und als das Fiasko ruchbar wurde, war sie nicht schnell genug vom Acker. (Foto: theland.com.au.)
In der neuesten Paradeplatz-Episode sind die Hauptfiguren ein vorbestrafter Hedge-Funds-Manager und ein wild gewordener australischer Bauer. Beiden hat die Credit Suisse (CS) Milliardenkredite nachgeworfen. Das Risiko war hoch, aber schneller Extraprofit lockte. Beide stürzten ab. Einblicke in den Maschinenraum des Finanzkapitalismus, 13 Jahre nach der grossen Finanzkrise.
WAS GESCHAH BISHER?
2021 sollte es bei der Credit Suisse Rekordgewinne und Boni regnen, nach zehn Jahren Affären und Debakel (US-Hypotheken, Wirecard, Hedge-Funds York Capital, Überwachungsaffäre, usw.). Und nach Milliardenbussen in den USA. So sprachen CEO Thomas Gottstein und der nun abtretende VR-Präsident Urs Rohner noch vor wenigen Wochen. Dann brachen kurz nacheinander zwei Geschäftspartner der CS zusammen, der Hedge-Fund Archegos und die Fintech-Firma Greensill. Problem: Die CS war in beiden Finanzvehikeln nicht nur mit besonders hohen Krediten engagiert, sie hat teilweise auch deren Geschäfte organisiert. Darauf wurden die Risikochefin und der Chef der Investmentbank in der CS (plus ein paar weitere Kader) gefeuert.
Ende April muss die Bank die Schleier über ihren Verlusten lüften. work schätzt: Es dürften 6 bis 8 Milliarden Franken sein.
Archegos-Gründer Hwang hat schon einmal einen Fonds in den Sand gesetzt.
WAS WAR ARCHEGOS?
So hiess ein Hedge-Fund des US-Spekulanten Bill «Tiger» Hwang. Hedge-Funds sind die Strassenräuber des Finanzkapitalismus. Mit möglichst wenig eigenem Geld, aber hoher Hebelwirkung organisieren sie zum Beispiel die Plünderung von Unternehmen, wetten auf Rohwarentermingeschäfte und seltsame Wertpapierderivate und manipulieren Devisenmärkte. Seinen Hedge-Fund deklarierte Bill Hwang als «Family Office», als private Vermögensverwaltung. Das entzog ihn dem Blick der Finanzaufsicht. Hwang hatte schon 2012 einen Hedge-Fund in den Sand gesetzt und ist wegen Insiderhandels vorbestraft. Das kratzte die CS nicht. Sie diente sich dem Spekulanten als «Prime Broker» an, als Brücke zum Markt und schützender Paravent. Hwang bezahlte gut. Das Risiko bestand im sechs- bis siebenfachen Hebel, den die CS zuliess: Mit 15 Dollar konnte Hwang Wetten über 100 Dollar abschliessen. Als ruchbar wurde, dass er sich verzockt hatte, zogen sich die US-Banken blitzartig zurück. Goldman Sachs soll dabei sogar noch Geld verdient haben. Die CS handelte spät und verlor sofort über 4 Milliarden Franken.
WER IST GREENSILL?
Alexander «Lex» Greensill posiert gerne als Bauer. Am liebsten an den Hebeln eines Traktors auf den 3200 Hektaren grossen Ländereien seines Familienclans in Australien. Hier sei seine Geschäftsidee entstanden, plaudert er und flunkerte als Fintech-Guru von «Demokratisierung des Kapitals». Dafür hat ihn die britische Monarchie zum Ritter geschlagen, der frühere konservative Premier David Cameron war sein eifrigster Lobbyist. Er habe schon 150 Milliarden Dollar umgesetzt, lässt Greensill wissen. Womit? In Wahrheit mit einer Idee aus dem alten Mesopotamien. Wenn einer Waren produziert und geliefert hat, dauert es oft lange, bis die Rechnung bezahlt wird. Hier springt Greensill ein, bezahlt sofort, aber mit einem Abschlag – und übernimmt die Forderung. Dieser Abschlag macht den Profit. «Lieferketten-Finanzierung» heisst das.
Die CS übernahm die Finanzierung. Von mehr als 1000 betuchten Kundinnen und Kunden, aber auch von Pensionkassen und Gemeinden liess die CS vier Greensill-Fonds füllen. Sie waren seine Kasse. Nur: Die Margen aus den Abschlägen waren dem Privatjet-Landwirt zu gering. Also verwurstete er die Schuldverschreibungen immer wieder neu zu Derivaten, die gehandelt werden konnten. Riskant. Zudem nutzte er die CS-Fonds als heimliche Bank. Greensill finanzierte mit dem Geld den Stahlkocher Sanjeev Gupta. Dieser kaufte sich in der ganzen Welt ein Stahlimperium zusammen. Noch riskanter war es, in die Derivate «Luftbuchungen» einzubauen, also Deals, die gar nie stattgefunden hatten. Als schliesslich auch die Versicherungen der Fonds ausstiegen, brach das Kartenhaus zusammen.
Wahnsinn: Boni-Bonanza
So verbrennt die CS Geld: Seit 2011 hat die Grossbank an die obersten 2 Prozent ihrer Belegschaft 14 Milliarden Franken ausbezahlt. Das ist fast doppelt so viel wie der kumulierte Gewinn derselben Periode (8,1 Milliarden). Die rund 1000 vergoldeten Bankerinnen und Banker arbeiten in der Investmentbank, also ausgerechnet in jener Abteilung, die immer wieder katastrophale Verluste und extreme Risiken produziert. Bankintern heissen sie die «Risk-Taker» (Risikonehmer). Absurd, denn sie riskieren allenfalls das Geld der Kundschaft.
HAT DIE CS DAS SCHLIMMSTE HINTER SICH?
Kaum. Was da an Verlusten zusammenkommt, weiss derzeit niemand. Nachdem die CS schon ein Loch von 4,4 Milliarden Franken aus der Archegos-Pleite eingestanden hatte, musste sie über Ostern in Notverkäufen weitere Aktienpakete abstossen. Dabei verlor die Grossbank noch mehr Geld.
Wie teuer Greensill wird, zeigt sich in den kommenden Wochen. Manche der Fonds-Kunden finden, die CS habe sie zu entschädigen. Um etwa 4,5 Milliarden Dollar könnte Streit entstehen, genährt unter anderem durch eine Recherche der britischen Wirtschaftszeitung «Financial Times»: Offenbar waren manche Gupta-Deals, die den Greensill-Fonds teilweise zugrunde lagen, fiktiv. Im Klartext: Betrug. Selbst wenn Greensill die CS getäuscht haben sollte, wird die Bank ihrer reichen Kundschaft entgegenkommen. Schon allein, um weiteres juristisches Ungemach abzuwenden. Bereits hat der US-Senat von der CS Aufklärung in der Sache Archegos verlangt.
Doch vielleicht liegt das grösste Problem anderswo. Die Bargespräche unter Bankern drehten dieser Tage um die Frage, ob in der CS oder in anderen Banken weitere Zeitbomben ticken. Ein Genfer Finanzanalyst sagt es so: «Noch so ein Riesenbums, und wir haben einen internationalen Finanzsturm.» Doch viele Banken fahren volles Risiko. Motto: Der letzte lösche das Licht. Sogar die bankenfreundliche NZZ titelte konsterniert: «Mehr Risiken in den Portfolios denn je.»
WO KOMMT DAS VIELE GELD HER?
Perverse Situation: Viele Menschen und KMU wissen nicht, wie sie in Covid-Zeiten über die Runden kommen sollen. Jamie Dimon aber, der Boss der US-Bank JP Morgan, bat kürzlich die Grosskonzerne, doch bitte ihren Cash abzuziehen. Dimon möchte die Einlagen auf 200’000 Millionen Dollar begrenzen. Denn seine Bank ertrinkt im Geld wie fast alle grossen Finanzkonzerne. Es stammt zum Teil aus den Rekordprofiten der letzten Jahre. Vor allem aber kommt das Geld von den Zentralbanken und Regierungen, die in der Krise, die lange vor Covid begann, Banken und Wirtschaft mit Billiggeld fluteten. So ist die Bilanz der US-Bundesbank FED heute neunmal höher als 2008. Theoretisch ist das nicht falsch. Es sollte die Banken dazu anregen, die Wirtschaft mit frischem Kredit anzukurbeln. Doch im neoliberalen Kapitalismus investieren Aktionäre kaum noch in die materielle Ökonomie. Die Lohnquote sinkt (und damit die Kaufkraft), die Verschuldung der Haushalte steigt. Die Profite wachsen, und die Gewinnsteuern sind gering wie nie. Also treiben, mitten in einer multiplen Wirtschaftskrise, ungeheure Summen das Finanzcasino an. Es zockt so wild wie nie.
Die Blase wächst und wächst. Doch viele Banken fahren weiter volles Risiko.
KOMMT JETZT DIE NÄCHSTE FINANZKRISE?
Eigentlich ist das die falsche Frage, findet der Zürcher Finanzprofessor Marc Chesney. Er sieht in der gegenwärtigen Blase «eine weitere Episode der Dauerkrise». Derzeit stehen alle Indikatoren auf Rot, etwa das Verhältnis von Gewinnen zu den Börsenkursen. Die Finanzmärkte haben sich vom realen Geschehen der Wirtschaft noch mehr abgekoppelt. Inzwischen nehmen sogar zahllose Normalverdienende Kredite auf, um mitzuzocken.
Heute rüsten sich Zentralbanken und Regierungen für den grossen Crash. Etwa für Bankenzusammenbrüche am Ende der Covid-Massnahmen, wenn viele Firmenkredite ausfallen könnten. Oder für extreme Turbulenzen, sollten die Zinsen schnell ansteigen.
Doch genau besehen, sind die Krisenretterinnen und -retter seit 2008 im Dauerstress: Quasi täglich wenden sie mit neuen Techniken, Finanzinstrumenten und koordinierten Massnahmen den Totalcrash ab. Es ist eine rasende Flucht nach vorn geworden. Denn diese Krise ist längst systemisch: sozial, wirtschaftlich, ökologisch.
WAS GESCHIEHT MIT DER CS?
Alles bald wieder im Lot, meldet derweil die CS: Die Aufräumarbeiten seien im Gange. «Ohne Tabus», versichert CEO Gottstein. Es werden noch diverse Köpfe rollen, die Abteilungen der Bank werden neu aufgestellt, vielleicht wird die Investmentbank (17’500 Beschäftigte) ausgegliedert, und natürlich wird es eine Menge heiliger Versprechen von CS-Sprechern geben. Alles wie gehabt. Nur: Kein einziger Gesprächspartner von work in der Bankenwelt glaubt, dass es die CS in einem Jahr noch so gibt, wie sie vor Archegos und Greensill war. Einige denken, die Grossbank, die schon lange im Besitz von internationalen Fonds ist, werde nun filetiert. Vor allem das dicke CS-Kundenbuch der Superreichen lockt. Blackrock, der weltgrösste Anlagefonds (mit Ex-Nationalbankchef Philipp Hildebrand als Vize) würde sich gerne das Asset-Management der CS schnappen. Und nicht nur er.
Diverse Drahtzieher aus Finanz und Politik arbeiten heimlich an einer anderen Lösung, die unter der Hand schon lange kursiert: die Fusion von UBS und CS zur Monsterbank. Grüezi Klumpenrisiko!
Stiftungsräte: Augen auf!
Heute weiss auch die Finanzmarktaufsicht (Finma) nicht, wie viel Kapital die Pensionskassen durch die Flops der Credit Suisse mittlerweile verloren haben. Auf die Informationen der Banken können sich die Kolleginnen und Kollegen in den Stiftungsräten von Pensionskassen ohnehin nie verlassen. Mehr denn je gilt: Augen auf. Transparenz durchsetzen. Vor allem aber machen Geldschwemme und Minuszinsen deutlich: Das PK-Geld muss endlich in den sozialen und ökologischen Umbau fliessen.