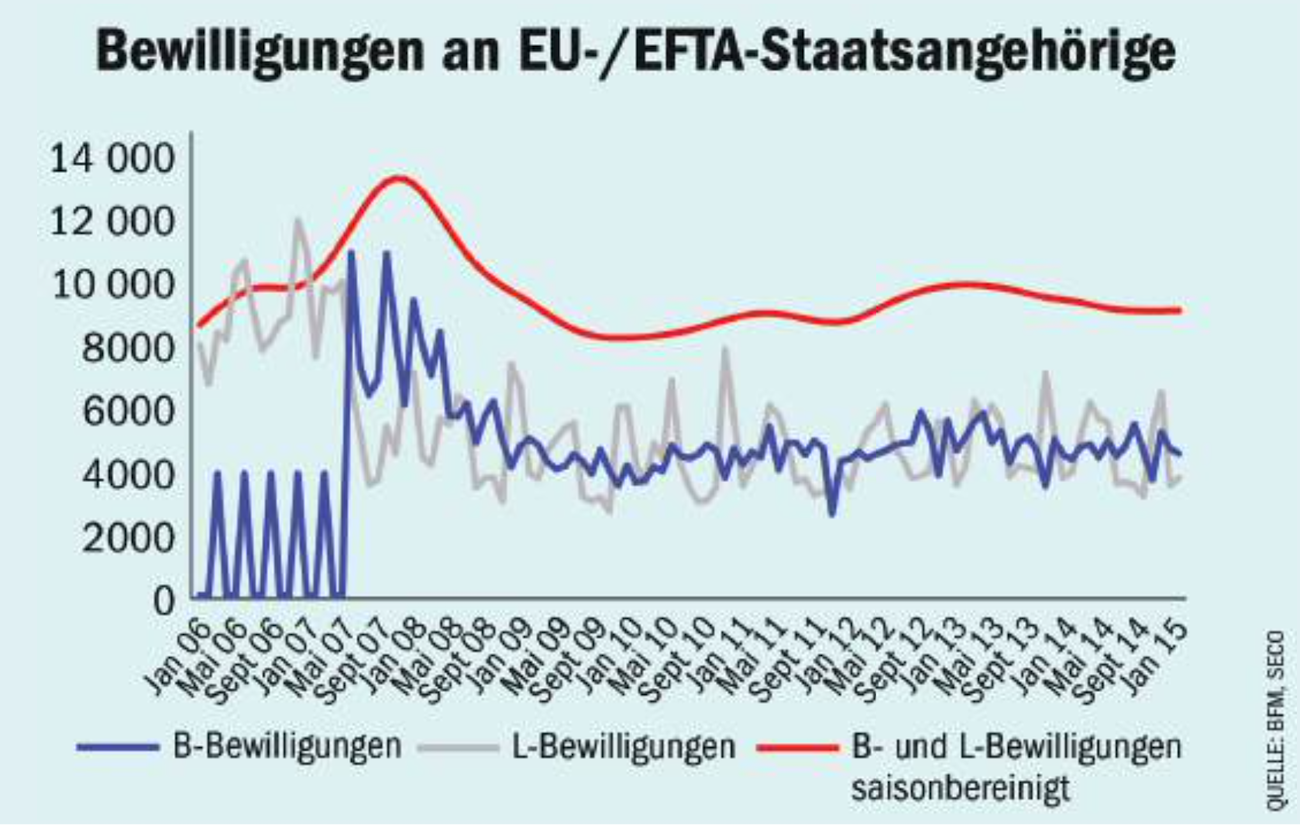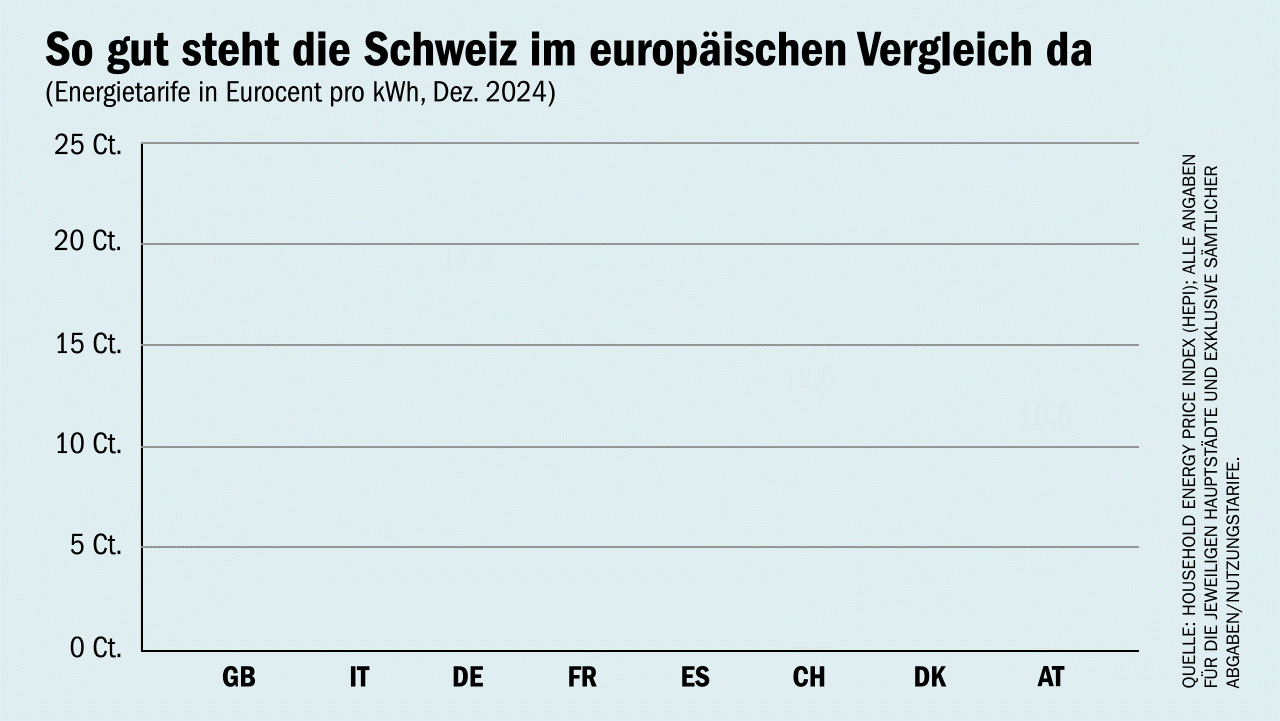Vorschlag der Gewerkschaften und ArbeitgeberBundesrat sagt Ja zum Lohnschutz-Paket – das steht drin
In den vergangenen Wochen haben Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände ein Massnahmenpaket verhandelt, mit dem der Lohnschutz in der Schweiz auch mit dem neuen EU-Abkommen gesichert werden kann. Der Bundesrat hat diesen...