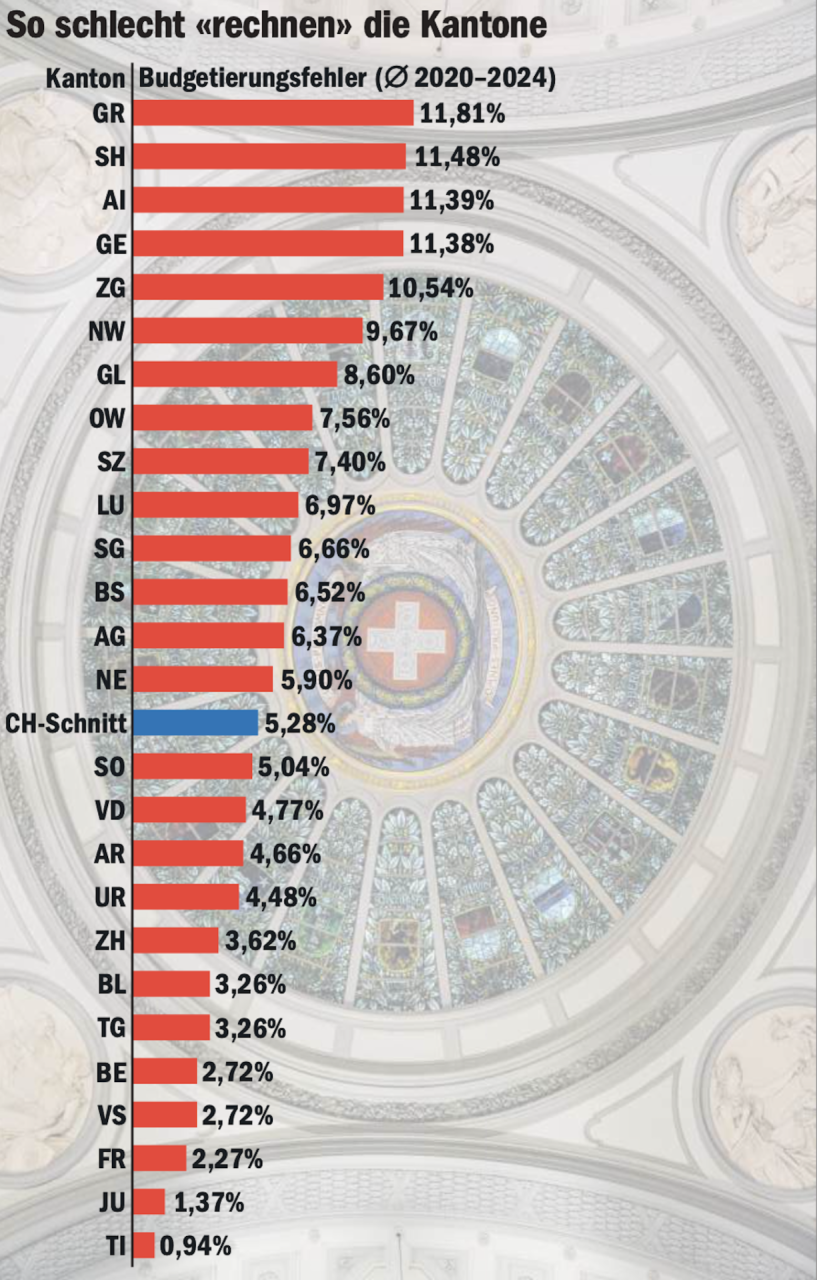Jetzt Appell unterschreibenPflegeinitiative: Lieber Nationalrat, bitte den Auftrag umsetzen!
Die Rechten wollen die Pflegeinitiative aushöhlen. Jetzt rufen Gewerkschaften und Verbände die Bevölkerung auf, sich für eine gute Gesundheitsversorgung zu engagieren.