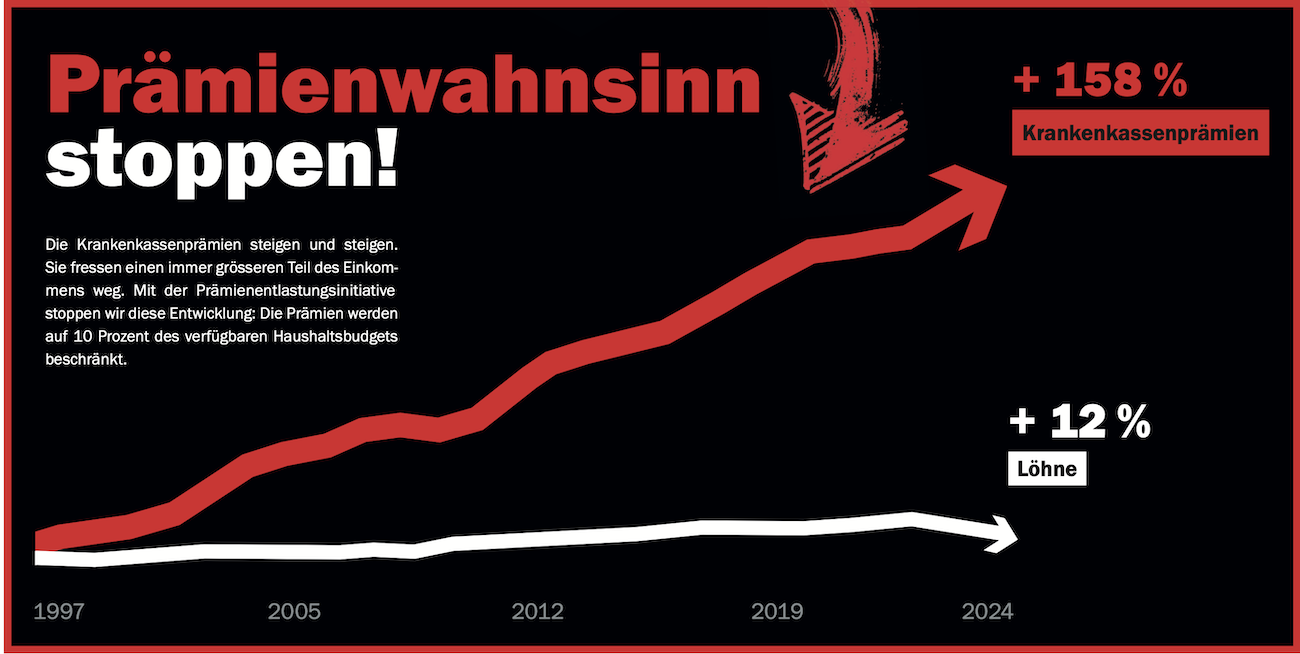48 Jahre lang herrschte in Portugal eine Diktatur. Doch am 25. April 1974 geschah das Unglaubliche: Fortschrittliche Offiziere und Soldaten brachten in einem minutiös geplanten Putsch das ganze faschistoide Regime zum Sturz – und zwar binnen weniger Stunden. Weite Teile der Zivilbevölkerung bejubelten den fast unblutigen Coup und steckten den Soldaten Nelken in die Gewehrläufe. Gleichzeitig trat die Arbeiterschaft eine veritable Revolution los und trieb die Demokratisierung in allen Bereichen voran. Heute ist der 25. April der Nationalfeiertag der Republik Portugal. Auch in der Unia ist die Erinnerung an die Nelkenrevolution hellwach und sehr divers – kein Wunder bei über 26 000 portugiesischen Mitgliedern!
Clique aqui para ver a tradução portuguesa do artigo.
Alexandrina Farinha (63), Konsulatssekretärin, Genf«Von meinem Onkel fehlt bis heute jede Spur»

Foto: ZVG
«Am 25. April 1974 war mein erster Streik! Ich war noch Schülerin in einem kleinen Dorf in der Region Alentejo. Es war unsere Lehrerin, die uns das Streiken beibrachte. Von uns hatte ja niemand eine Ahnung. Unser Horizont war sehr beschränkt, denn Portugal war komplett abgeschottet, ein völlig rückständiges Land, in dem die Regierung alles kontrollierte: Radio, Zeitungen, Fernsehen, Bildung. Bei uns in der Provinz war es noch schlimmer. Viele Mädchen gingen bloss vier Jahre zur Schule, die Analphabetenrate war hoch, die Leute arm, auch wir. Mein Vater ging bei Sonnenaufgang in die Fabrik und kehrte erst nach Sonnenuntergang wieder heim. Meine Mutter machte, was es gerade gab. Leben hiess arbeiten und noch mehr arbeiten. Entsprechend früh starb man. Mit 45 galt man bereits als alt!
Echte Gewerkschaften gab es nur im Untergrund. Denn Kritik war gefährlich. Wer sich beschwerte, riskierte, von der Nationalgarde abgeholt und umgebracht zu werden. Andere wurden Opfer des Verschwindenlassens. Von meinem Onkel fehlt bis heute jede Spur. Aber am meisten Tote gab es in den Kolonialkriegen, vor allem im heutigen Angola, in Moçambique oder in Guinea-Bissau. Soldaten wurden massenhaft eingezogen und dort verheizt. In meinem Dorf hatte es deshalb fast keine jungen Männer mehr. Sie waren entweder im Militär oder davor ins Ausland geflohen. Unsere Revolution begann denn auch in den Kolonien. Die Soldaten selbst wollten diese sinnlosen Kriege beenden. Und so blies plötzlich ein ganz anderer Wind. Von einem Tag auf den anderen erstrahlte Portugal in neuen Farben. Plakate, Flugblätter, Fahnen überall. Zudem riesige Menschenmassen auf der Strasse. Und dann die Musik! Endlich spielte das Radio all die verbotenen Lieder. Da kamen Hunderte neue Songs aufs Mal, eine unglaubliche Vielfalt. Ich war hell begeistert von all dem und stürzte mich voller Tatendrang ins Getümmel.»
Angela Tavares (48), Gewerkschaftssekretärin, Siders VS«Meine Mutter sass im Konzentrationslager»

Foto: Unia
«Für mich bedeutet der 25. April vor allem Freiheit, also etwas, das meine Eltern lange nicht hatten. Meine Familie stammt aus den Kapverden. Das war früher eine Kolonie Portugals. Es herrschte Armut und sogar Hunger. Und weil meine Mutter als junge Frau Dinge gesagt hatte, die dem Regime nicht passten, wurde sie ins Geheimdienstgefängnis von Tarrafal gesteckt. Das war ein Konzentrationslager für linke politische Gefangene und Aktivisten der antikolonialen Unabhängigkeitsbewegung. Später gelang ihr die Flucht nach Lissabon, wo sie dann auch die Revolution mitmachte. Es muss eine einmalige Volksfeststimmung geherrscht haben. Meine Mutter erzählte, wie sie mit den aufständischen Soldaten getanzt und auch etwas über den Durst getrunken hatte. Als sie in den Morgenstunden nach Hause kam, trug sie nur noch einen Schuh.»
Oana Pica (60), Gewerkschaftssekretärin, Oberengstringen ZH«Ich sang aus voller Kehle mit!»

Foto: Fabian Biasio
«Der 25. April zeigt, dass sich das Volk aus eigener Kraft befreien kann. 1974 war ich erst ein zehnjähriges Mädchen. Doch als die Leute massenhaft auf die Strasse gingen und feierten, war auch ich dabei. Bei der Revolutionshymne ‹Grândola, vila morena› sang ich aus voller Kehle mit. Mein Stiefbruder war zuvor im Kolonialkrieg in Angola gefallen. Und meine Eltern waren überzeugte Sozialisten. Ich habe sehr wohl begriffen, dass sie unter der Diktatur extrem aufpassen mussten. Besonders mein Vater hatte immer für die Freiheit gekämpft, aber auch ums nackte Überleben. Wir stammen aus dem Alentejo, einer mausarmen Agrarregion im Süden. Für manche meiner Kolleginnen war das Mensa-Essen in der Schule die einzige richtige Mahlzeit am Tag. Meine Familie hatte es etwas besser. Denn mein Vater war Schmuggler und brachte begehrten Kaffee, Tabak oder Parfums aus Spanien. Damals herrschten eine Handvoll Grossgrundbesitzer über unsere Region. Ihre Villen wurden in der Revolution mit Hakenkreuzen beschmiert und ihre brachliegenden Felder besetzt. So wütend war das Volk!»
João Carvalho (54), Baumaschinist, Genf«Unsere Freiheit ist nicht vom Himmel gefallen»

Foto: ZVG
«Also bei uns im Dorf hat man von der Revolution nicht viel gespürt. Ich komme aus dem nördlichen Landesteil, und der unterscheidet sich komplett vom Alentejo, dem damals aufständischen Zentrum. Dort waren die Leute Landarbeiter und unter der Knute von wenigen Grossgrundbesitzern. Bei uns dagegen waren alles Kleinbauern, die selbst einen Flecken Land besassen. Mein Vater hatte Reben, Oliven, einen Gemüsegarten und ein paar Tiere. Damit kam unsere siebenköpfige Familie gut über die Runden. Aber klar, auch bei uns lauerte die Polizei überall, und man musste aufpassen, was man sagt. Und auch bei uns konnte die Generation meiner Eltern mehrheitlich weder schreiben noch lesen. Die Diktatur wollte halt, dass die Leute arbeiteten statt studierten. Denn je weniger ein Volk weiss, desto besser kann man es kontrollieren. Heute ist die extreme Rechte wieder auf dem Vormarsch. Auch viele meiner Landsleute in der Schweiz haben die ausländerfeindliche Chega-Partei gewählt. Dabei sind wir hier doch selber Migranten! Wir müssen also wieder mehr zeigen, dass unsere Freiheiten und Rechte nicht vom Himmel gefallen, sondern hart erkämpft worden sind. Das haben viele vergessen, gerade bei den Jungen!»
António dos Santos Pinto (85), pensionierter Elektroingenieur, Zürich«Der Geheimdienst hat uns ständig beschattet»

Foto: Isabelle Haklar
Die Diktatur unter António de Oliveira Salazar prägte mein Leben früh, denn ich bin in der damaligen Kolonie Angola geboren. Dort habe ich die Matura gemacht. Doch Universitäten gab es keine – weil die Kolonialherren das so wollten. Es gab aber jedes Jahr Stipendien für fünf Schüler, die dann in Portugal studieren konnten. Weil ich Klassenbester war, kam ich dafür in Frage. Doch die Verwalter haben alles getan, dass ich als Schwarzer abblitzte und ein weisser Mitschüler an meiner Stelle das Stipendium erhielt. Nur mit Hilfe meiner Lehrer, die beim Sozialamt vermittelten, erhielt ich doch noch einen Studienplatz in Porto.
Allerdings legte mir ein Beamter erneut Steine in den Weg. Er war ein sogenannter Mischling und stand in der rassistischen Klassenhierarchie über mir. Die Portugiesen hatten diese Hierarchie, die bis heute nachwirkt, ja in all ihren Kolonien installiert. Zuoberst rangierten die Weissen, dann kamen die Mischlinge und zuletzt wir Schwarze. Diese Gruppen waren dann weiter unterteilt. Bei uns Schwarzen gab es «Assimilierte» und «Indigene», letztere konnten als «Contratados» zur Arbeit gezwungen werden, was nichts anderes hiess, als dass sie zu Sklaven gemacht werden konnten. Ich gehörte zu den «Assimilierten». Wir erhielten das Bürgerrecht. Im Gegenzug durften wir nur Portugiesisch sprechen und schreiben. Wir mussten die europäische Kultur übernehmen, Militärdienst leisten, zum katholischen Glauben wechseln. Wir durften keine afrikanische Musik mehr hören und nur noch am Tisch mit Messer und Gabel essen. All das wurde bei uns zu Hause kontrolliert.
Ende 1960 schaffte ich es doch noch nach Portugal. Dort wurden wir Afrikaner ständig vom Geheimdienst beschattet, zumal in Angola gerade der Unabhängigkeitskampf begonnen hatte. Und wenn die Polizei drei Schwarze auf der Strasse antraf, trieb sie die Gruppe auseinander.
An der Uni war es nicht besser. Einmal wollte mich der Rektor zwingen, eine Rede zu halten. Ich sollte sagen, dass Angola für immer zu Portugal gehören werde. Das konnte ich natürlich nicht. Schliesslich hatte ich schon als Schüler eine klandestine Widerstandsgruppe gegründet. Also sagte ich, ich sei ein schlechter Redenschreiber. Der Rektor entgegnete, dass sowieso er den Text verfasse. Zur Eskalation kam es aber nicht, denn mit einer Gruppe anderer afrikanischer Studierender ergriff ich rechtzeitig die Flucht nach Frankreich. Dort wollte man uns aber nicht behalten. Denn Frankreich war selber noch eine Kolonialmacht und führte Krieg gegen die Unabhängigkeitsbewegung in Algerien. Über ein evangelisches Netzwerk um das Hilfswerk Heks gelangten wir schliesslich in die Schweiz. Nur weil diese Organisation für uns bürgte, durften wir hierbleiben.
Nach 15 Jahren Krieg wurde Angola am 11. November 1975 unabhängig. Ohne den antikolonialen Widerstandskampf hätte es keine Nelkenrevolution gegeben.
Revolutionsjubiläum: Die Unia feiert in Bern
Auf der ganzen Welt finden um den 25. April Jubiläumsfeiern für die Nelkenrevolution von 1974 statt. Auch die Unia organisiert einen Anlass. Zeitzeugin Alexandra Farinha und Zeitzeuge António dos Santos Pinto berichten vom Leben unter der Diktatur. Der Journalist Daniel Oliveira spricht über die Errungenschaften der Revolution und die politischen Gefahren der Gegenwart. Im Anschluss Diskussion, Apéro und Musik von Sänger Abel Fava.
Samstag, 27. April, 14 bis 18 Uhr, Unia-Zentralsekretariat, Weltpoststrasse 20, Bern (Übersetzungen in Portugiesisch, Deutsch, Französisch und Italienisch vorhanden)