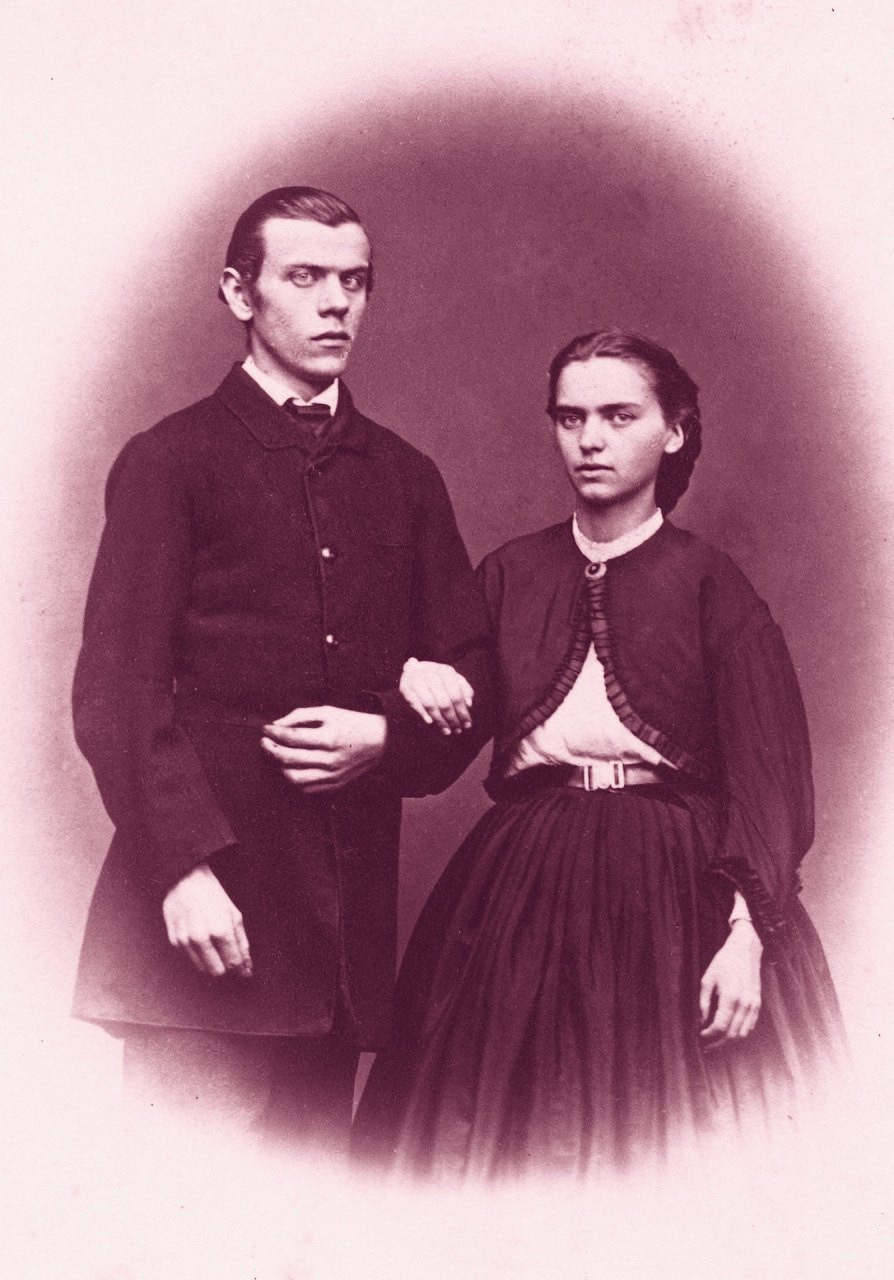Gewinnerfilm der Solothurner Filmtage: «Qui vit encore»Ein Film ohne Bilder für die Verstummten von Gaza
Eine leere Bühne steht im Zentrum des Gewinnerfilms der Solothurner Filmtage: «Qui vit encore» von Nicolas Wadimoff (61). Neune Überlebende des Krieges in Gaza berichten darauf über ihren Verlust und...