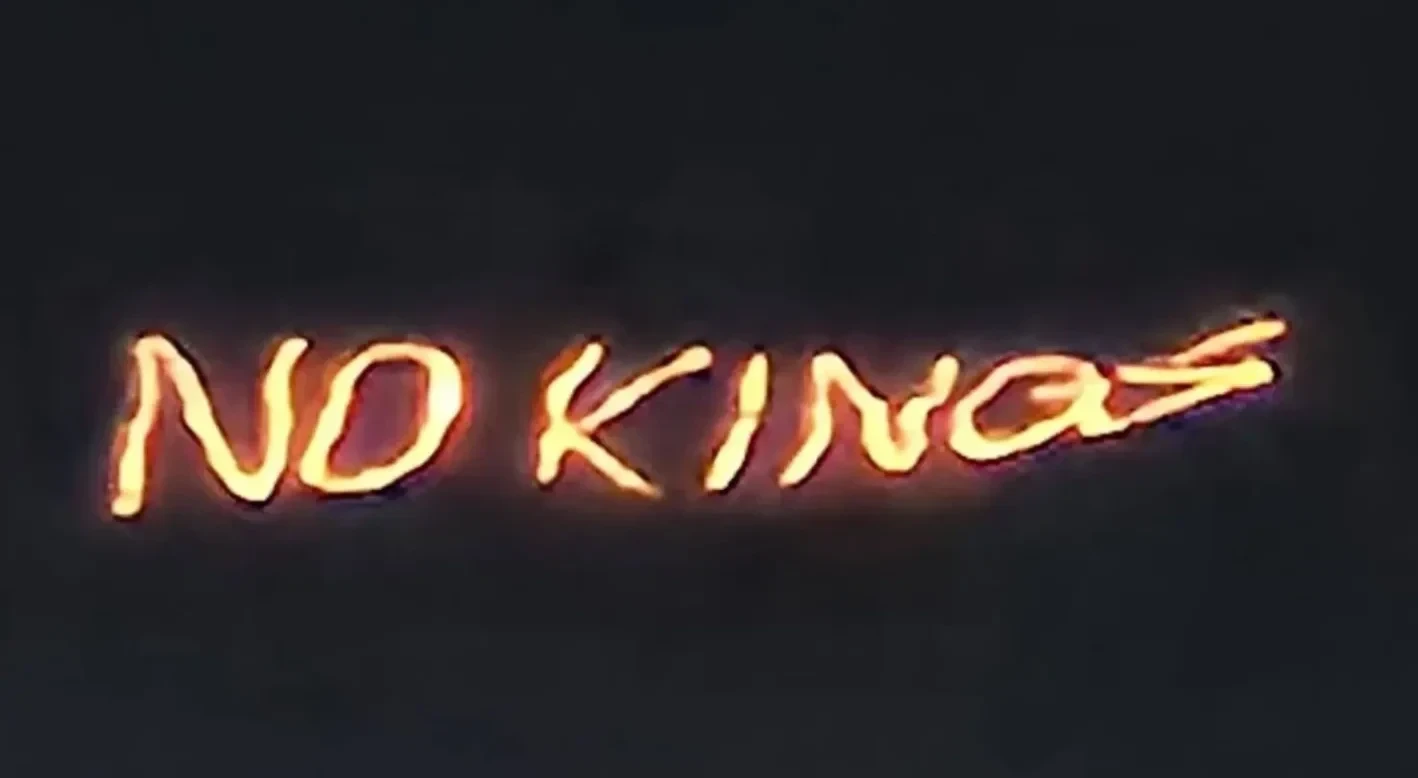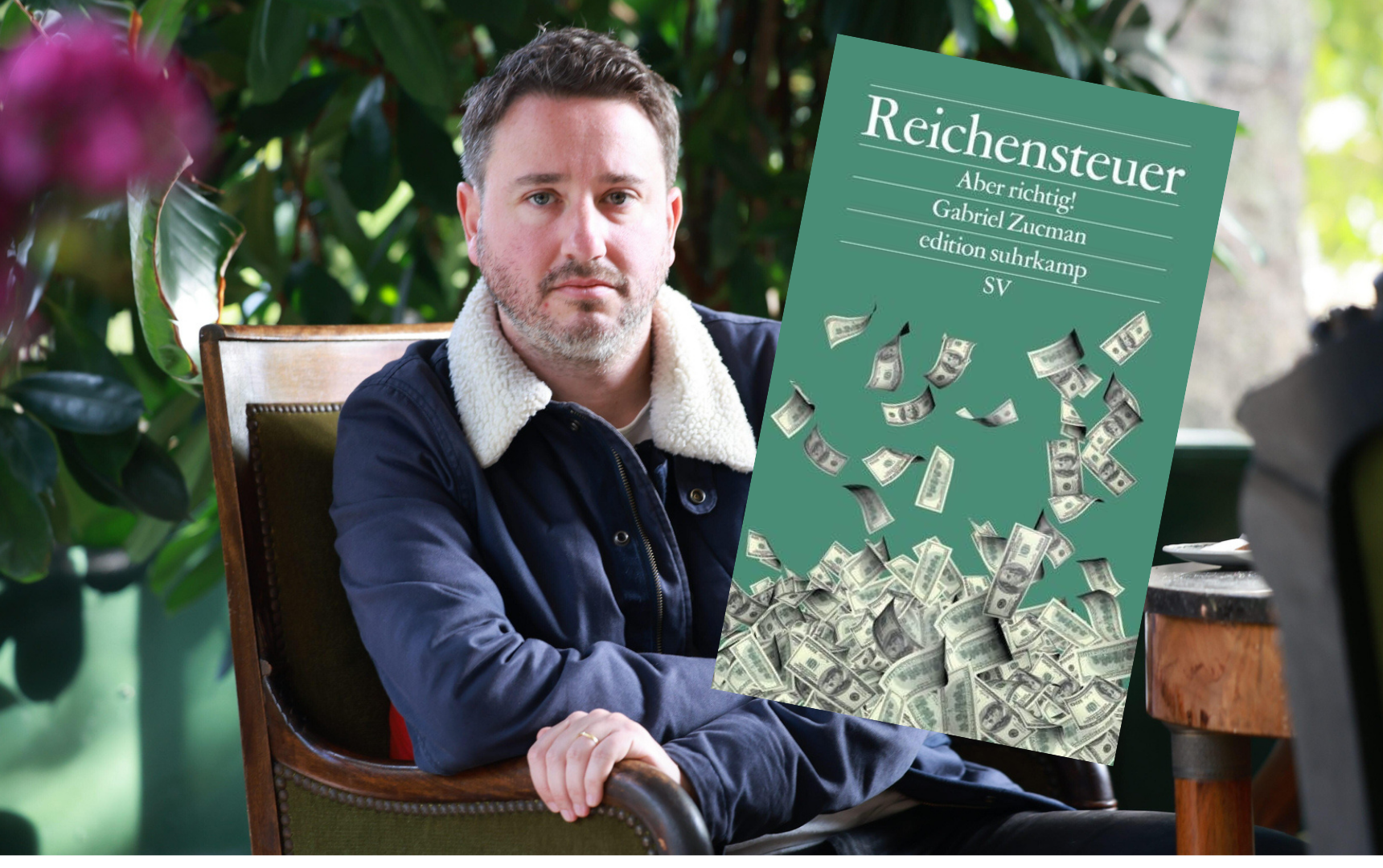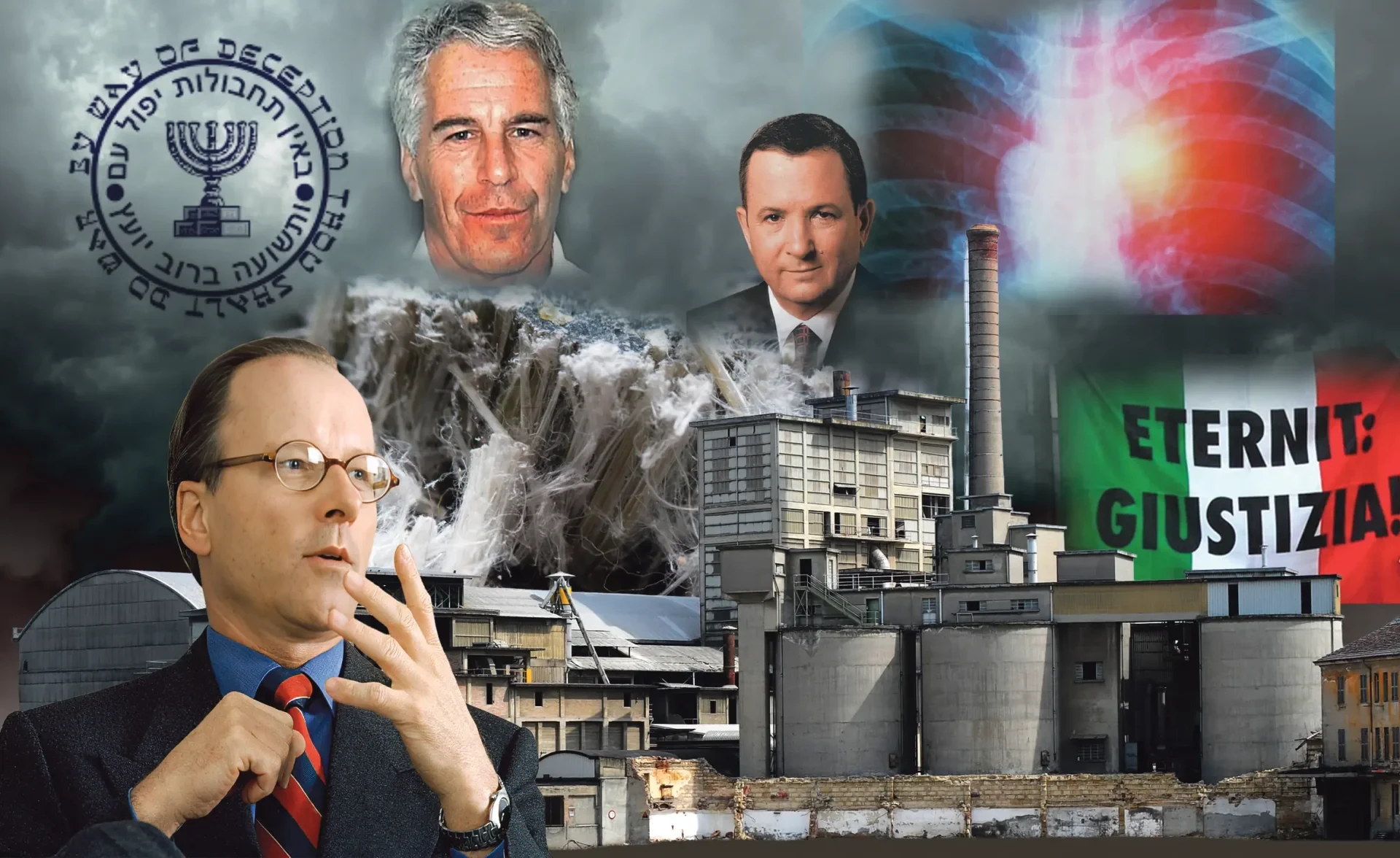No Kings: Ein GastkommentarWenn Fackeln mehr Haltung zeigen als der Bundesrat
Das Bild ging um die Welt: «No Kings» loderte in feurigen Buchstaben am Berg, 450 Fackeln setzten ein klares Zeichen gegen US-Präsident Donald Trump, gegen alle Autokraten, die sich am...