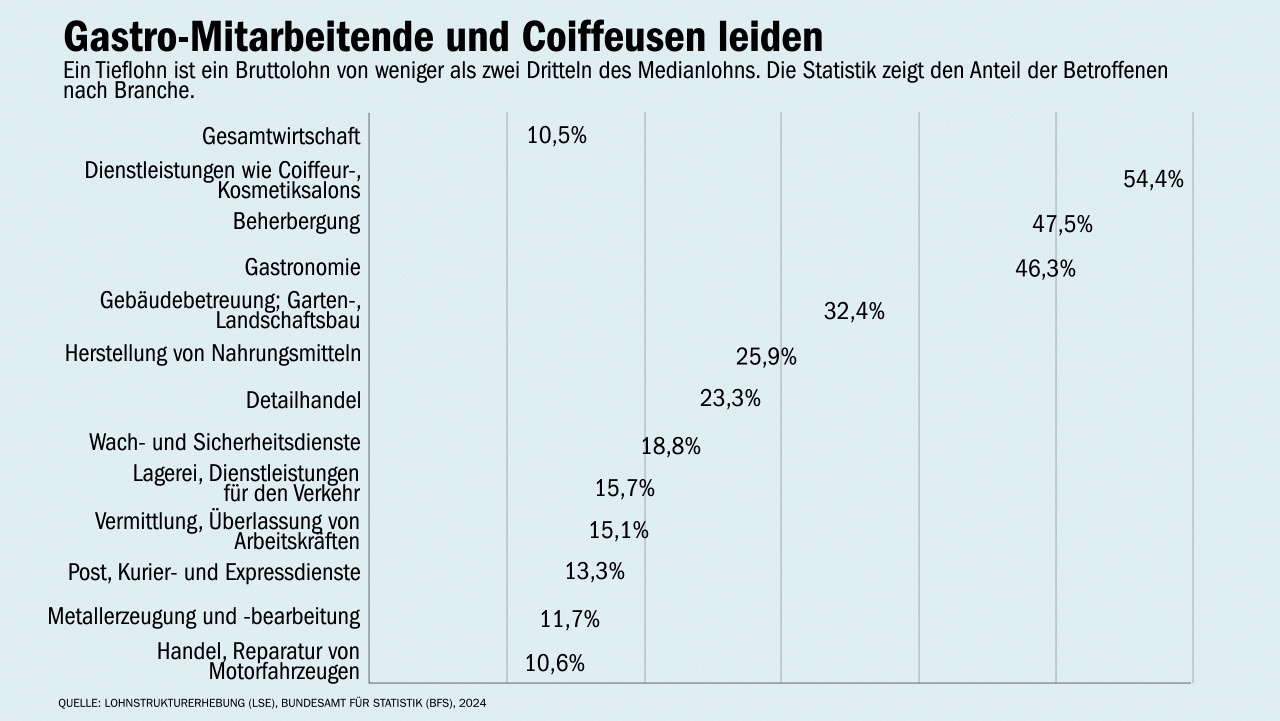Roland A. Müller schickt Vollzeitarbeitende aufs SozialamtArbeitgeber-Boss kämpft für Hungerlöhne
Dreistig- oder Ehrlichkeit? Arbeitgeberverbands-Direktor Roland A. Müller sagt in der Parlamentskommission: Löhne zum Leben sind nicht Aufgabe der Arbeitgeber. Tieflöhner sollen aufs Sozialamt. Auch bei einem 100-Prozent-Job.