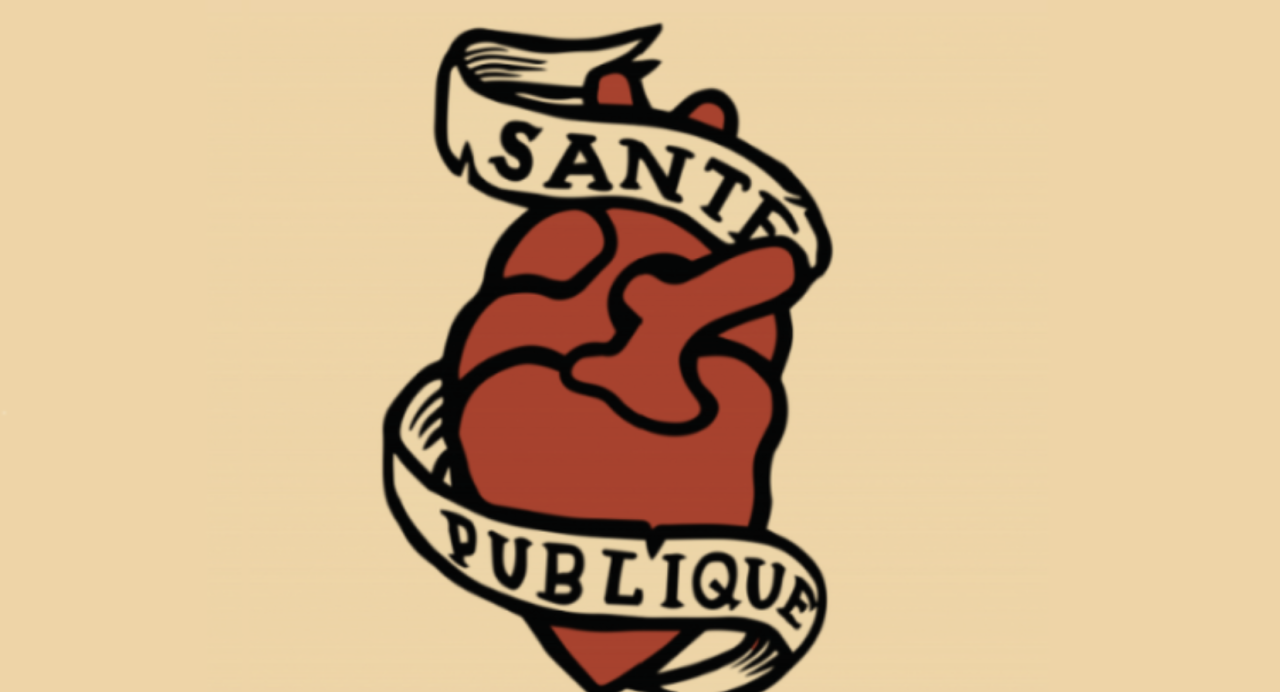Nationalrätin und Pflegefachfrau Farah Rumy:«Das System ist krank, nicht die Pflege»
Sie ist die Stimme der Pflege im Nationalrat: Als Pflegefachfrau kennt Farah Rumy alle Facetten dieses Berufs. Sie kritisiert den zahnlosen Bundesratsvorschlag zur Pflegeinitiative und bürgerliche Vorstösse, welche die Schwächsten...