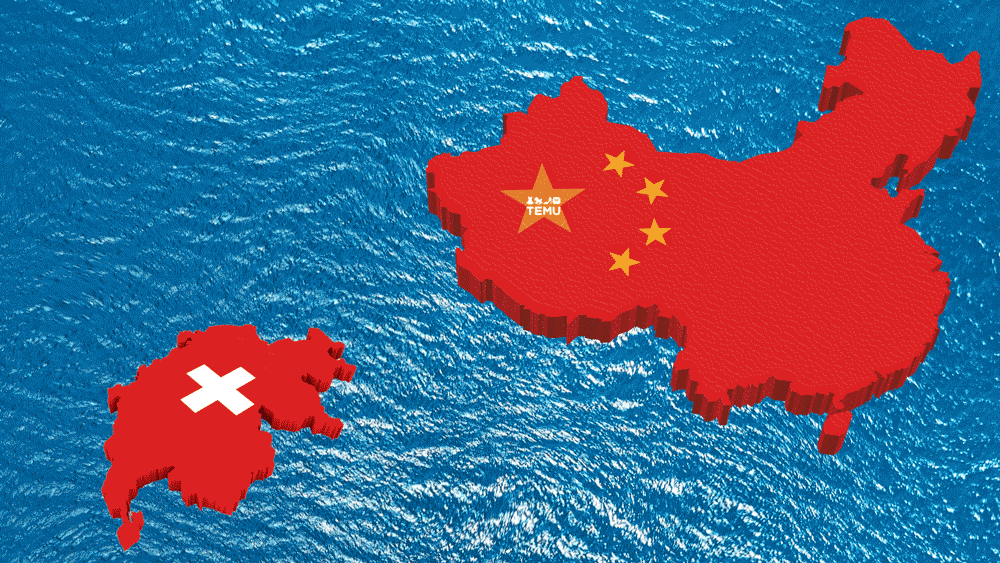Modebranche zur Nachhaltigkeit verpflichten«Das ist Abfall-Kolonialismus»
Mehr, schneller, billiger – nach diesem Prinzip funktioniert die Modeindustrie. Wegwerfkleider wachsen zu riesigen Abfallbergen an – zum Beispiel in Ghana. Ein Schweizer Modefonds soll dieses kaputte System nun stoppen....