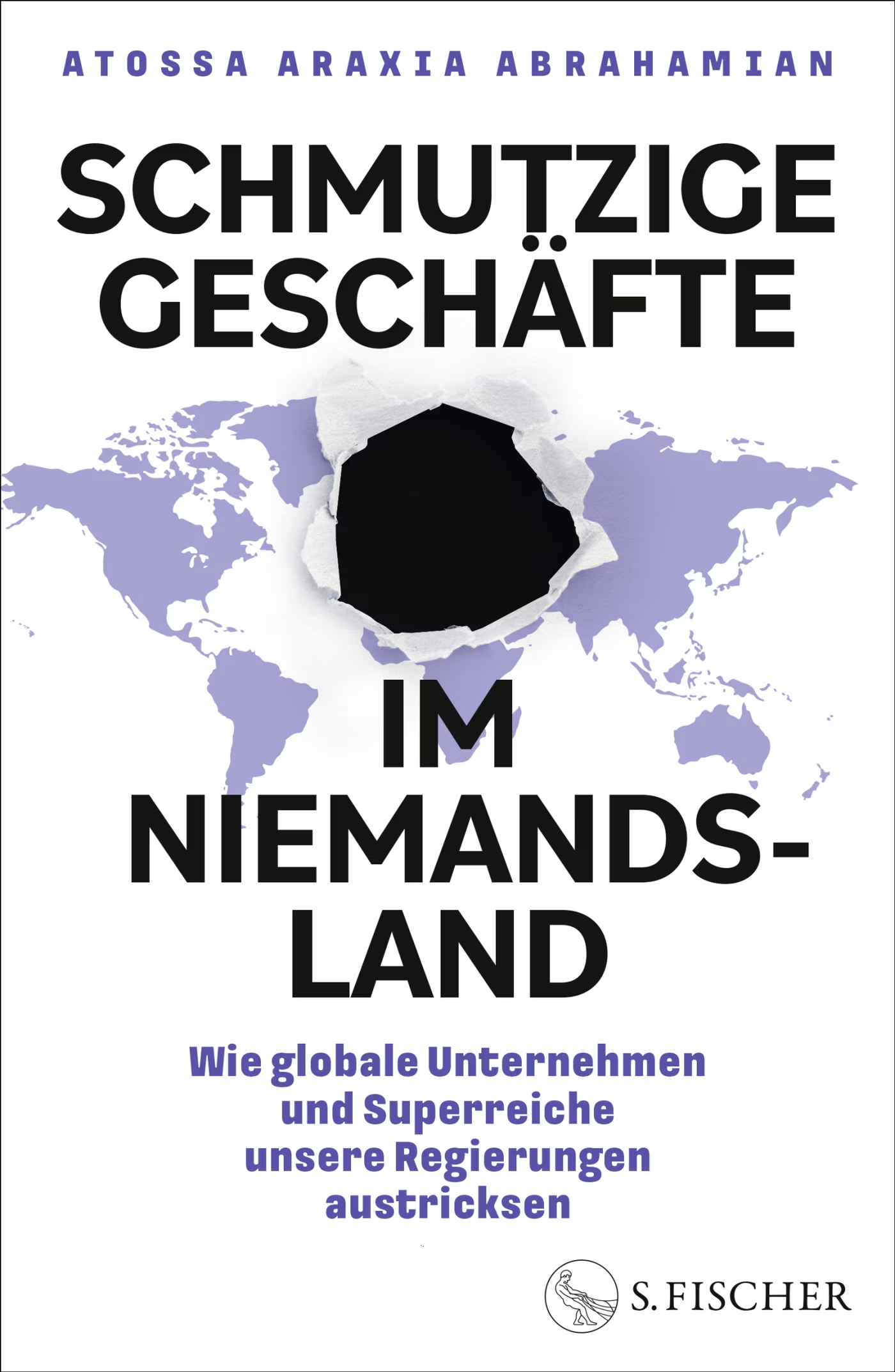Gewerkschaftliche Schwerpunkte für 2026Chrampfen muss gesünder werden – und besser bezahlt
Besserer Gesundheitsschutz und mehr Kaufkraft für die Lohnabhängigen: Das sind die Schwerpunkte des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes für 2026. Und SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard hat eine klare Botschaft für Arbeitgeber-Ideologen und rechte Politikerinnen...