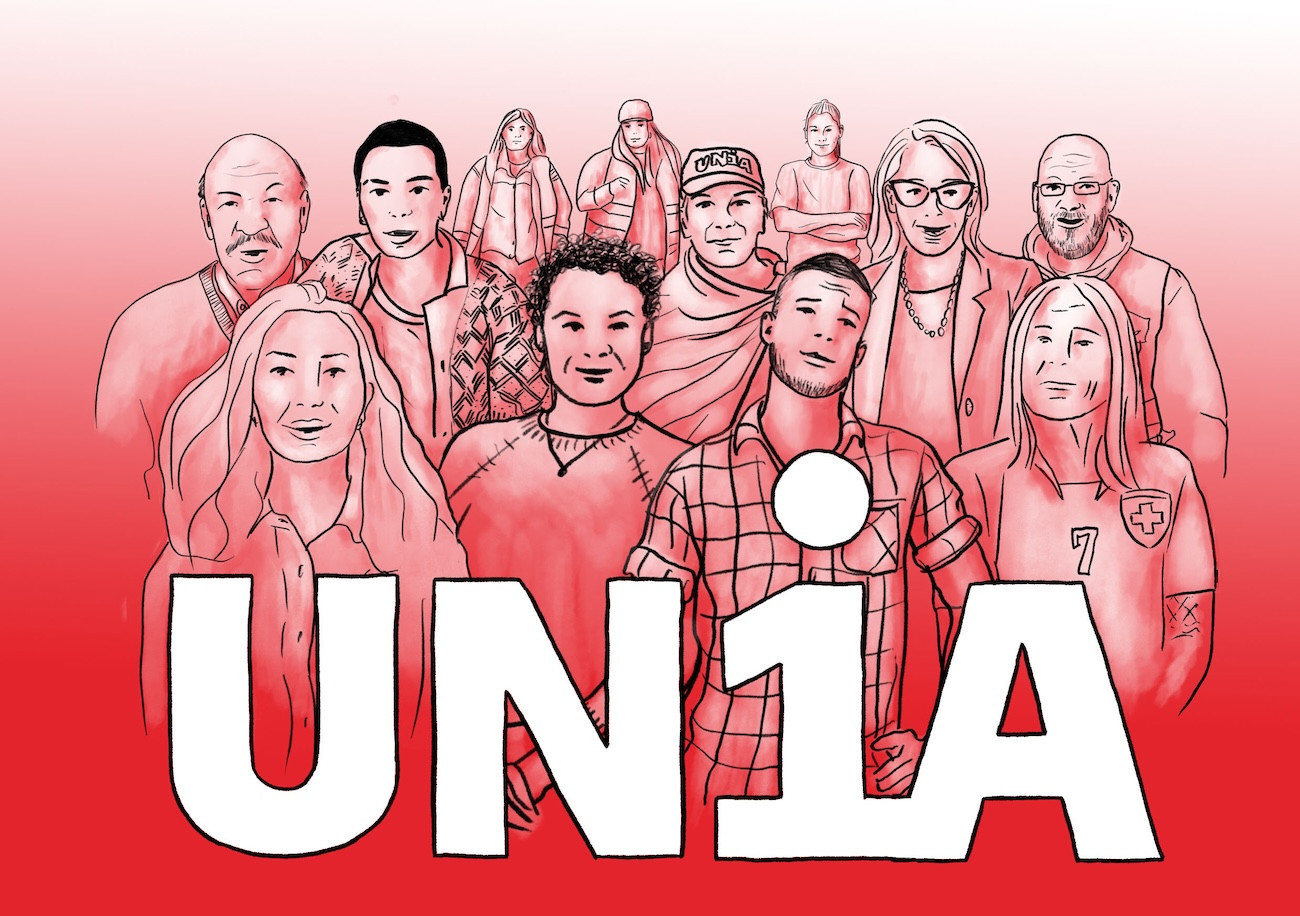US-Ökonomin Claudia Goldin zeigt: Sobald Kinder da sind, werden die Frauen in Sachen Erwerbstätigkeit um über hundert Jahre zurückkatapultiert.

CLAUDIA GOLDIN: Die Ökonomie zeigt auf, dass die Berufsmöglichkeiten der Frauen durch die ihnen zugeschriebene Verantwortung für die Familie eingeschränkt sind. (Foto: Getty)
Sie widerlegt mit Zahlen und Fakten, was sich hartnäckig als Behauptung hält, und belegt: Mehr Wirtschaftswachstum führt nicht automatisch zu mehr Gerechtigkeit. Die US-Ökonomin Claudia Goldin (77) konnte dies in ihrer bahnbrechenden Forschung in Bezug auf die Erwerbstätigkeit von Frauen und von Lohnunterschieden aufzeigen. Für ihr Lebenswerk über Lohnarbeit der Frauen und Lohnungleichheit hat Claudia Goldin jetzt den Nobelpreis für Ökonomie erhalten. Sie ist selbst eine Pionierin: Als erste Frau hat sie eine ordentliche Professur in Ökonomie an der Elite-Uni Harvard inne. Und erst als dritte Frau hat sie jetzt den Nobelpreis für Ökonomie erhalten, als erste Frau ganz für sich ganz alleine.
Goldin, die von der Uni Zürich den Ehrendoktor erhalten hat, sammelte in akribischer Feinarbeit Daten aus über 200 Jahren. Diese zeigen, dass der Anteil von arbeitenden Frauen in den USA in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mindestens ebenso hoch war wie heute, obwohl das Wirtschaftswachstum viel tiefer lag. In den Registern oft hinter der Bezeichnung «Ehefrau» versteckt, fand Goldin heraus, dass Frauen in den landwirtschaftlich geprägten Gesellschaften mehr leisteten als reine häusliche Arbeit. So trugen sie etwa in der Textilproduktion oder bei der Milchverarbeitung zum Haushaltseinkommen bei. Mit dem Beginn der industriellen Revolution ging die bezahlte Arbeit der Frauen zurück. Die kinderlosen Frauen arbeiteten in den Fabriken, die Mütter kümmerten sich um die Kinder. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren noch ungefähr 5 Prozent der verheirateten Frauen erwerbstätig.
Goldin selbst ist eine echte Pionierin.
FORTSCHRITTSPILLE
Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Erwerbstätigkeit der Frauen auf fast 50 Prozent in den 1970er Jahren, wo sie bis heute weltweit stagniert (die Erwerbstätigkeit der Männer beträgt 80 Prozent). Dieser Anstieg ist auch auf die Einführung der Antibabypille in den 1960er Jahren zurückzuführen. Sie ermöglichte es den Frauen, das Kinderkriegen eigenständig zu planen und sich länger auszubilden. Goldin konnte auch nachweisen, dass sich die gesellschaftlich erwarteten Rollen der Mütter stark auf die Berufswahl und spätere Erwerbstätigkeiten der Frauen über Generationen hinweg auswirkten. Die Ausbildungsverläufe der Frauen änderten sich erst ab den 1970er Jahren. Heute sind in den Industrieländern die Frauen generell sogar besser ausgebildet als die Männer. Seit den 1970er Jahren sind denn auch die Lohnunterschiede kleiner geworden, aber noch längst nicht verschwunden.
BABY-KNICK
Am geringsten waren die Lohnunterschiede zwischen Männern und (unverheirateten) Frauen während der industriellen Revolution, weil alle gleich (schlecht) nach produzierter Stückzahl entlöhnt wurden. Mit dem Aufkommen der Monatslöhne wurden die Frauen wieder schlechtergestellt, da die Firmen Arbeitnehmer mit langen, ununterbrochenen «Karrieren» bevorzugen.
Für Goldin ist klar, dass die Berufsmöglichkeiten der Frauen bis heute durch die Ehe und die ihnen zugeschriebene Verantwortung für die Familie eingeschränkt sind. In einem Interview mit der «Financial Times» nennt Goldin diesen Umstand das «schmutzige kleine Geheimnis, das wir alle kennen, über das wir aber nicht sprechen wollen». Denn noch immer sind es hauptsächlich die Frauen, die sich um den Nachwuchs kümmern und deshalb ihre Pensen reduzieren, weniger gut bezahlte Jobs annehmen müssen oder gleich ganz aus der Arbeitswelt aussteigen. Das zeigen auch aktuelle Zahlen aus der Schweiz: die Lohnkurve von kinderlosen Frauen und Männern entwickelt sich ungefähr gleich. Bei Paaren mit Kindern bildet sich aber ein markanter Knick zuungunsten der Frauen ab. Mütter verdienen im Vergleich zu Vätern auch zehn Jahre nach der Geburt noch durchschnittlich bis zu 68 Prozent weniger.