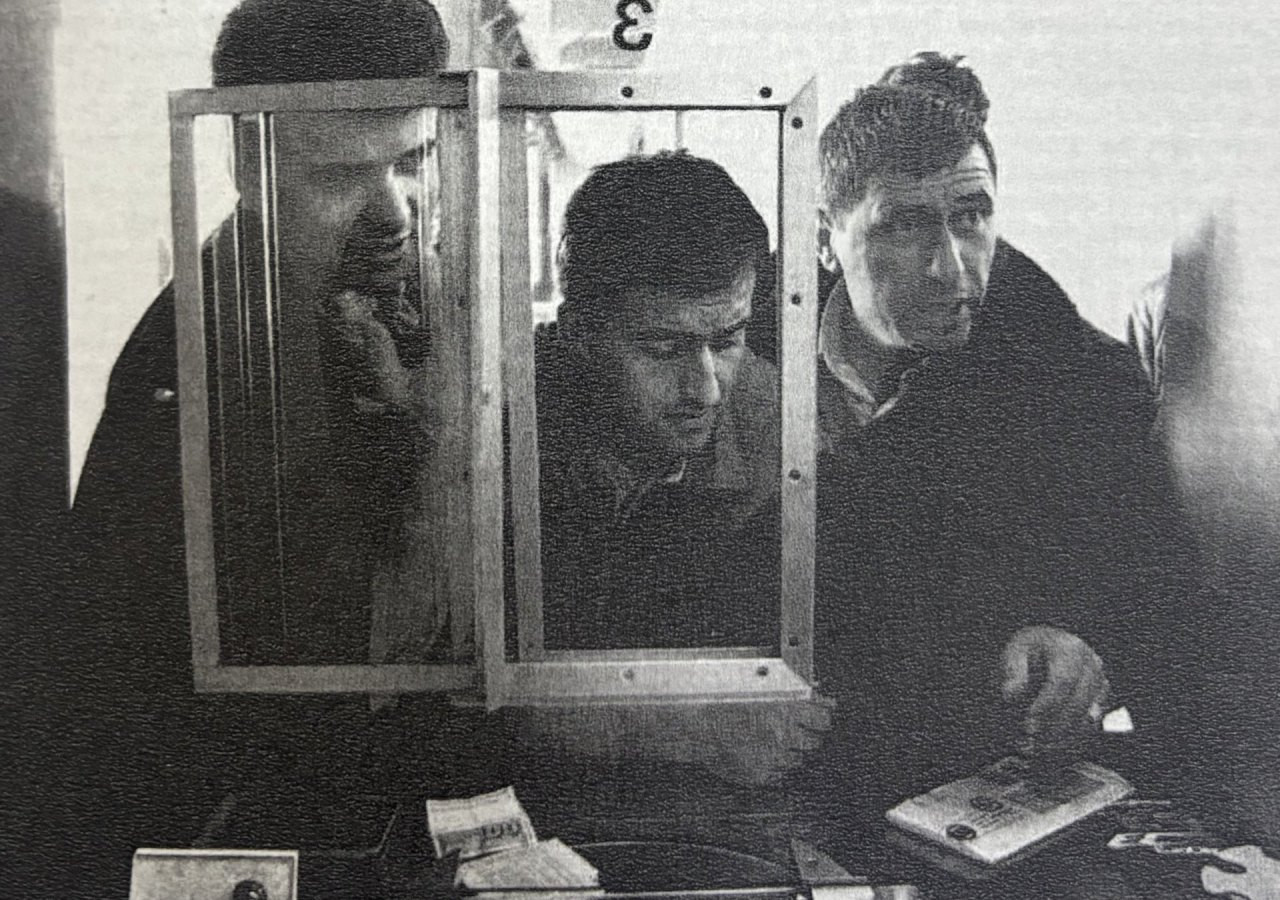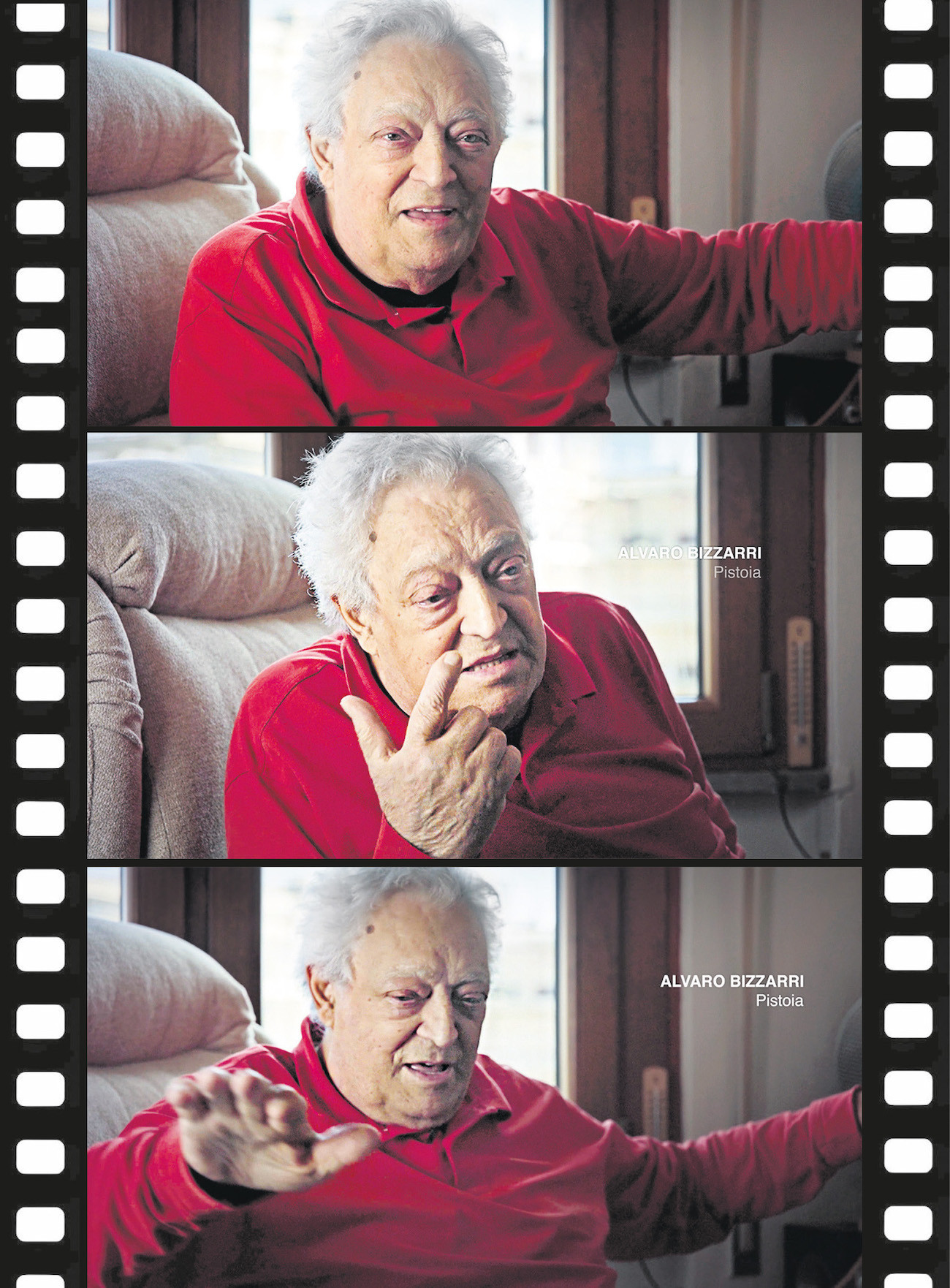«Keine 10-Millionen-Schweiz!»-Initiative entwürdigt MenschenDie SVP greift unsere Löhne frontal an
Die SVP lanciert seit Jahren die gleiche Initiative unter anderen Titeln. Aktuell ist als «Nachhaltigkeitsinitiative» verpackt, was nur eines will: zurück zum menschenverachtenden Saisonnierstatut, zu tieferen Löhnen für (fast) alle...