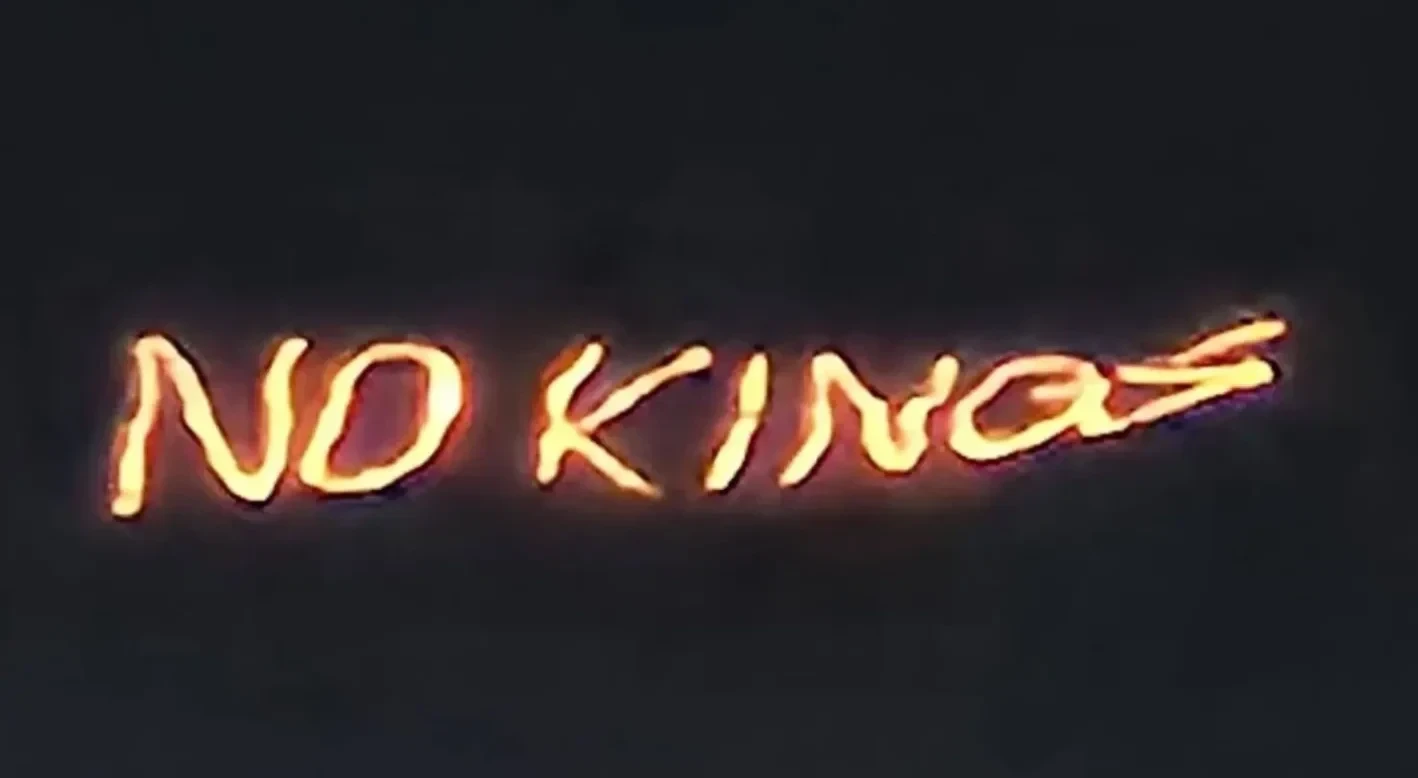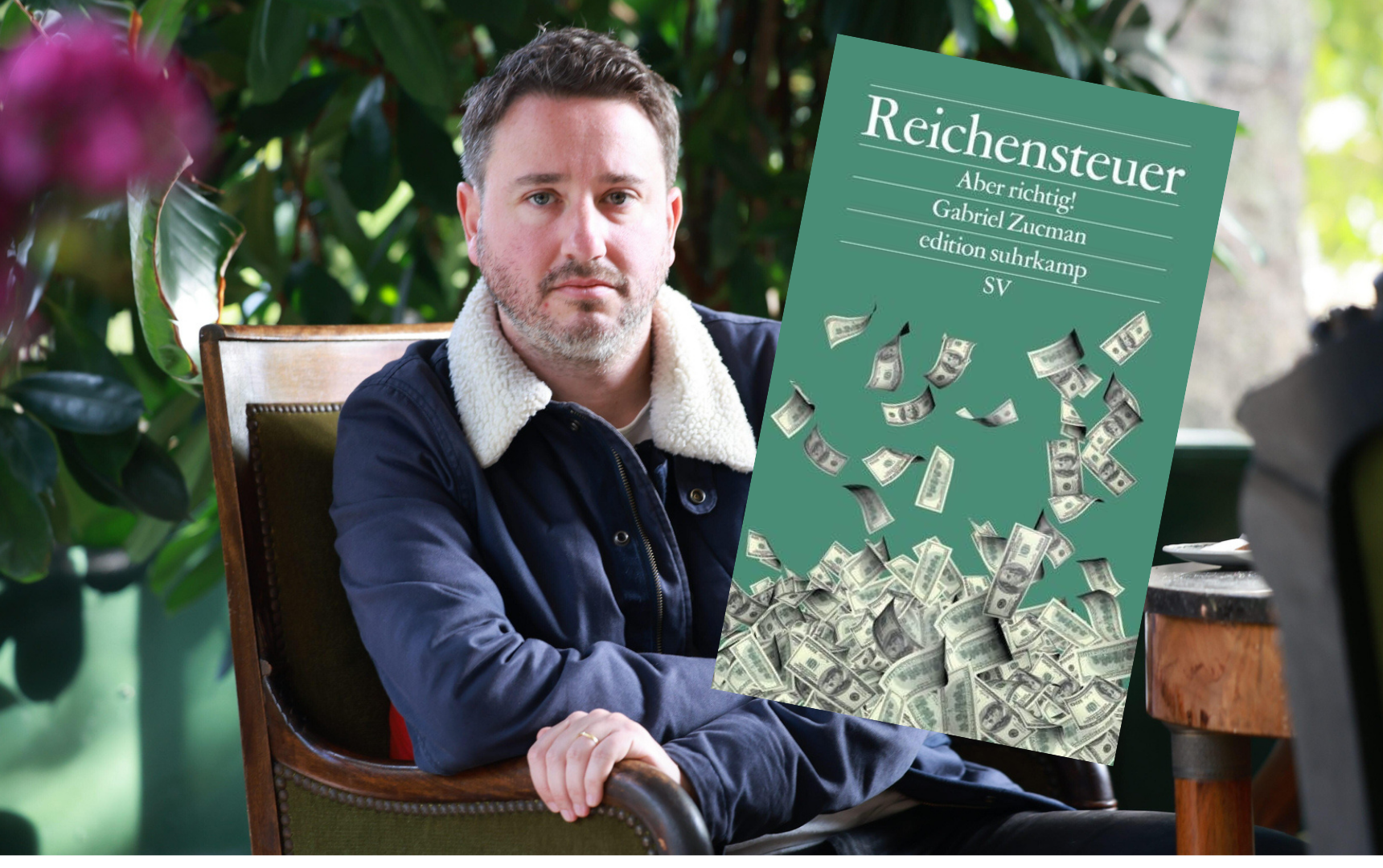MindestlöhneWarnsignal an Hungerlohn-Fans
Die bürgerliche Parlamentsmehrheit will kantonale Volksentscheide zum Mindestlohn aushebeln. Davon will das Volk nichts wissen, wie eine Umfrage zeigt. Die Gewerkschaften haben das Referendum schon angekündigt. Kommt der Ständerat noch...