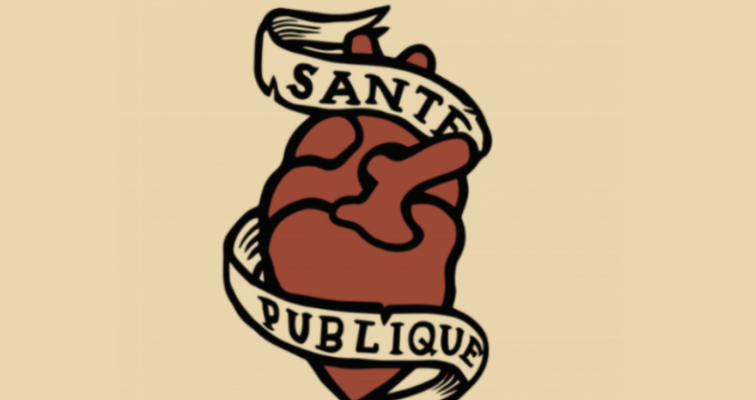125 Jahre Caritas: Das grosse Interview mit Direktor Peter Lack«Jede sechste Person in der Schweiz kann sich kein würdiges Leben leisten»
Über 1,2 Millionen Menschen sind in der Schweiz von Armut bedroht – Tendenz steigend. Die Caritas Schweiz hilft diesen Menschen seit 125 Jahren. Zum grossen Jubiläum erzählt Direktor Peter Lack,...