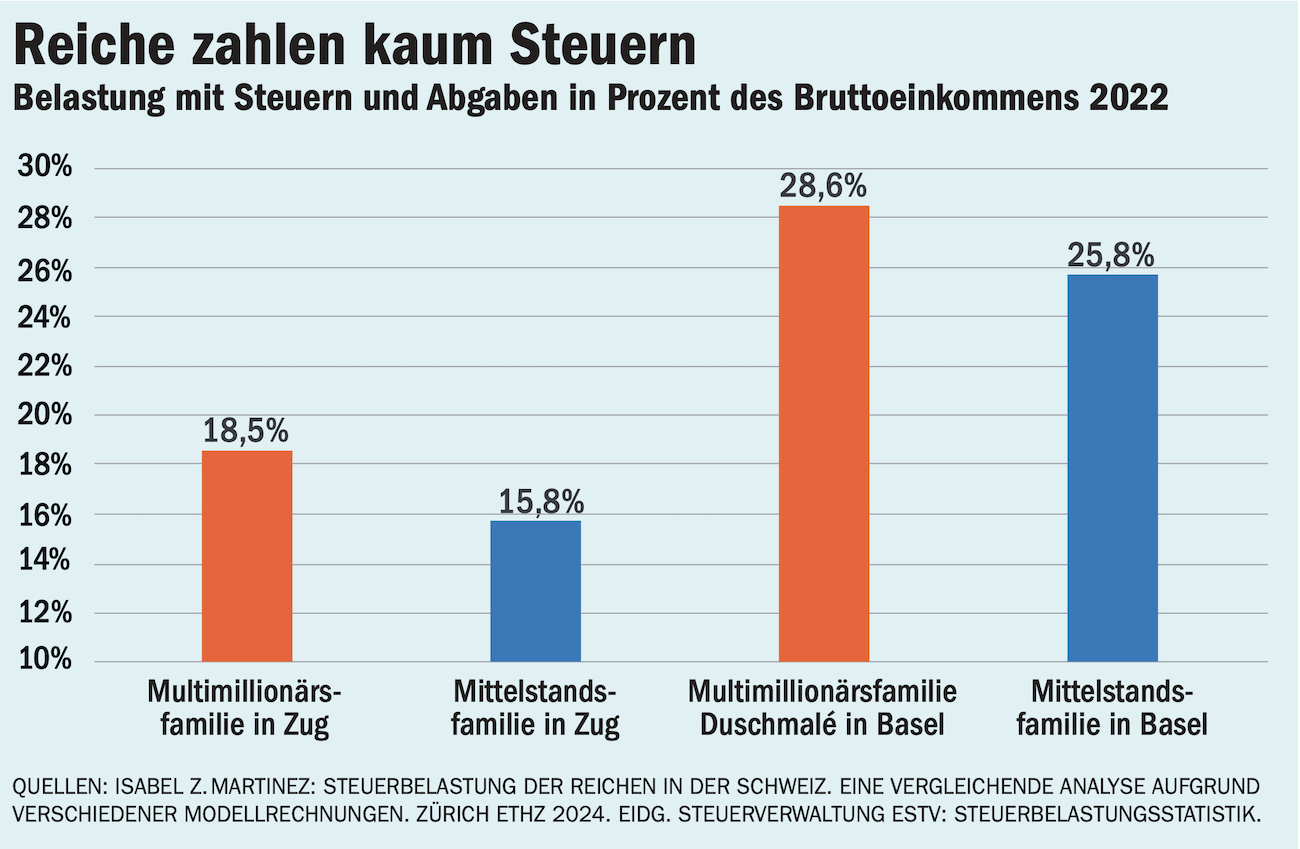Neuer Oxfam-Bericht über UngleichheitSuperreiche: Nicht machen, sondern nehmen
Milliardär Donald Trump übernimmt die Macht, und damit auch seine superreichen Einflüsterer. Gleichzeitig tümmelt sich ab heute am WEF in Davos die Geldelite. Die Konzentration von Reichtum bei einigen wenigen...