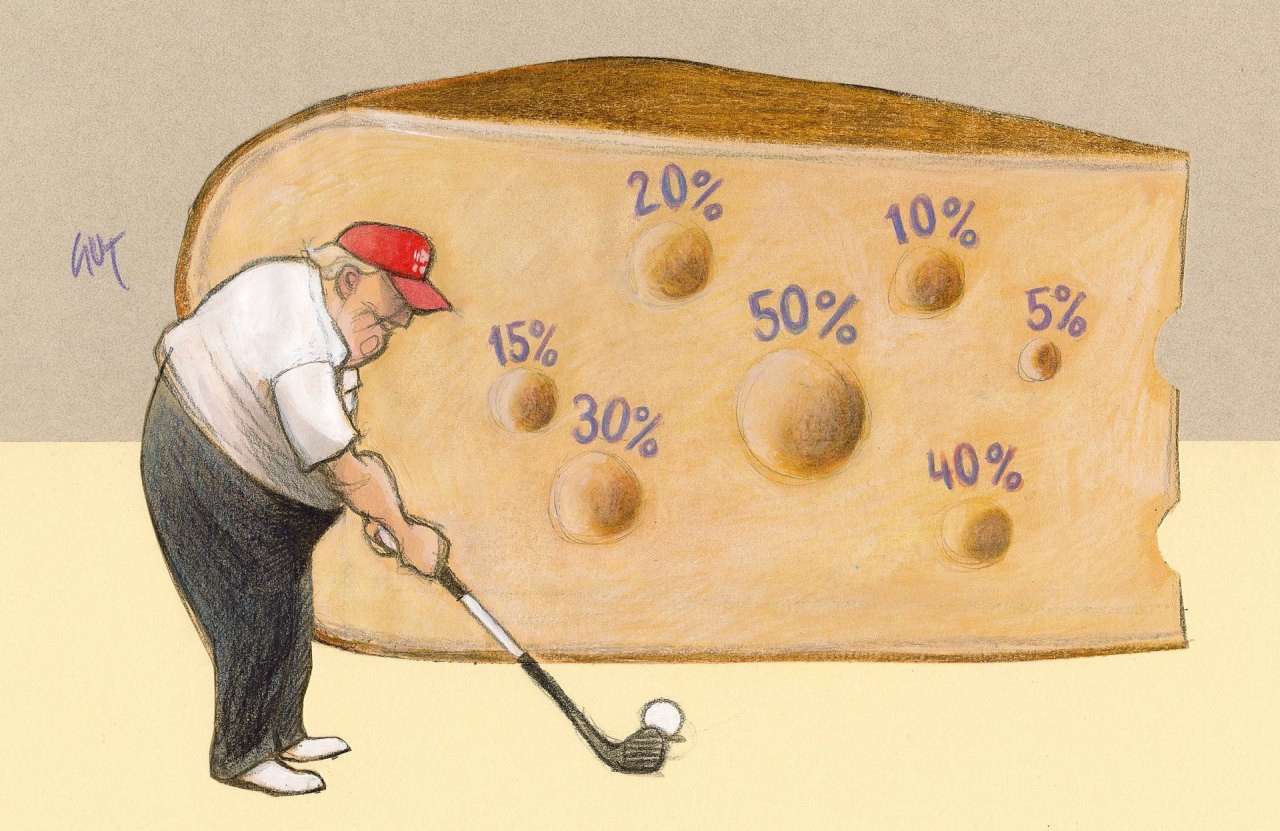Uhrenarbeiter packt aus«Die Arbeitgeber machen Druck auf die Löhne»
Uhrenarbeiter Dario Danilo* (49) aus dem Kanton Neuenburg berichtet, was die Kurzarbeit und der Zoll-Wahnsinn für ihn bedeuten.