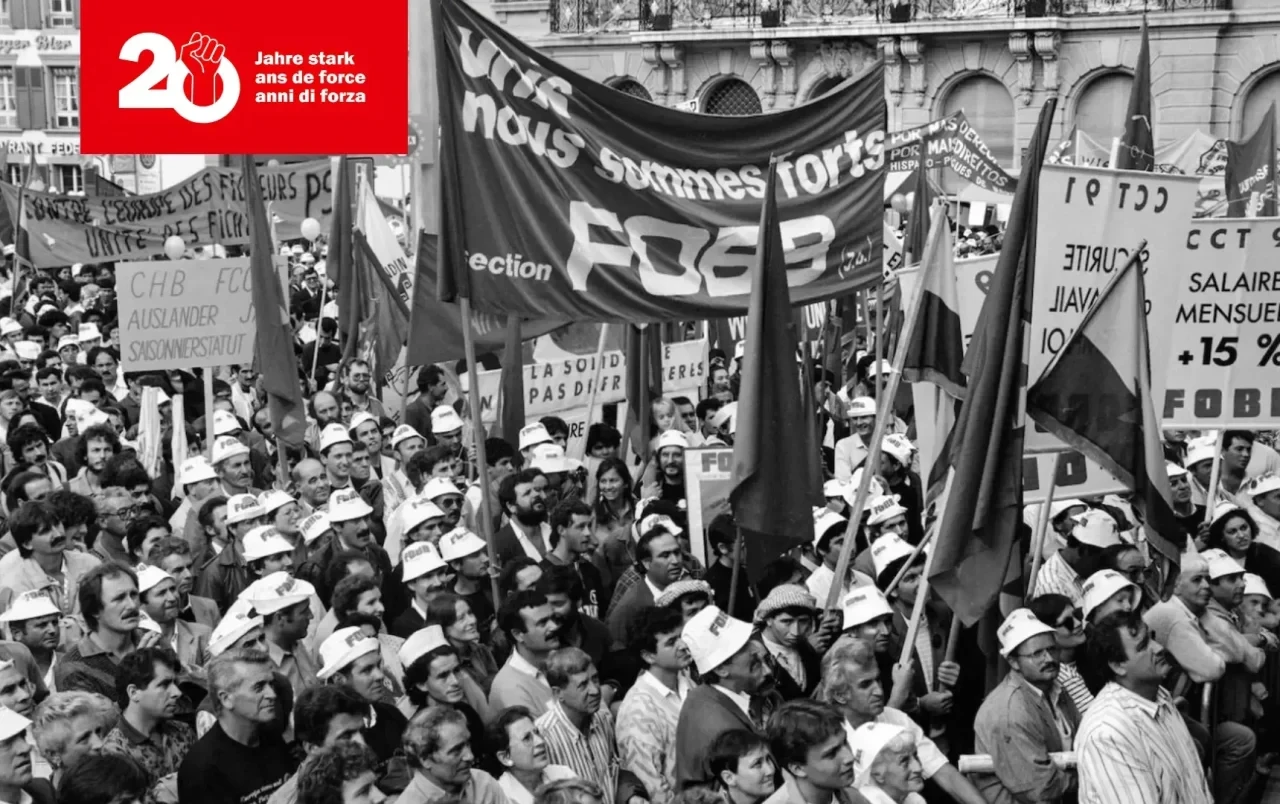Katastrophe von Prilly: Justiz reagiert auf vernichtenden Expertenbericht«Gerüsteinsturz war nur eine Frage der Zeit»
Stümperhafte Planung und schlechte Kontrollen haben wohl zum tödlichen Gerüsteinsturz auf einer Suva-Baustelle geführt. Jetzt nimmt die Justiz einzelne Arbeitnehmer ins Visier. Doch das Sicherheitsproblem liegt tiefer. TRÜMMER. Innert 5...