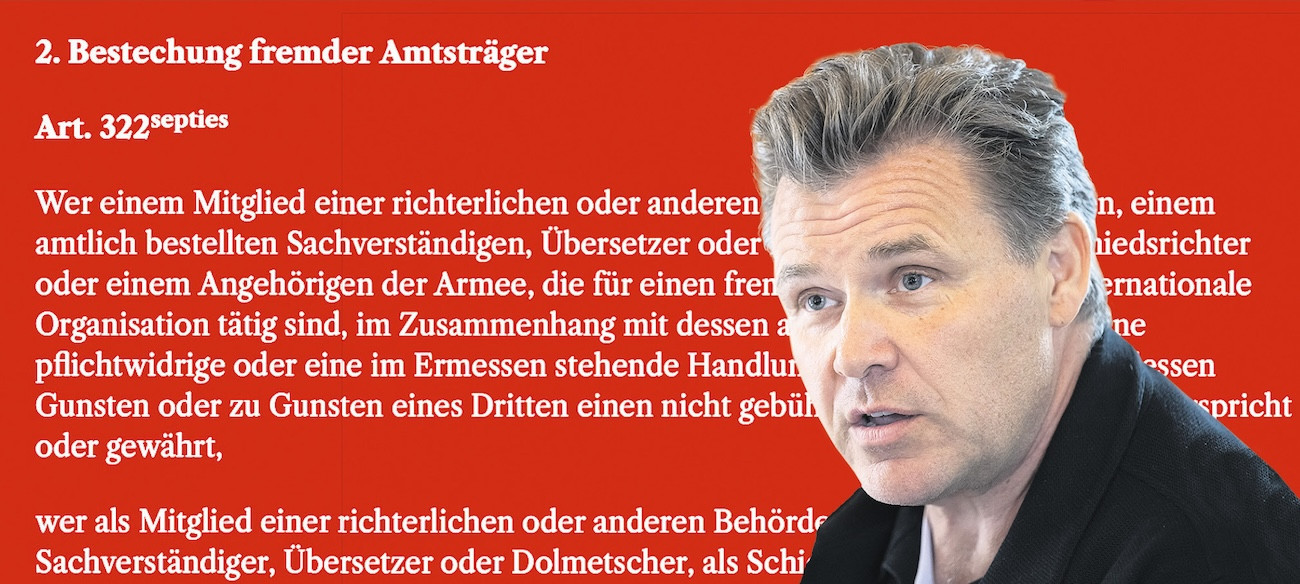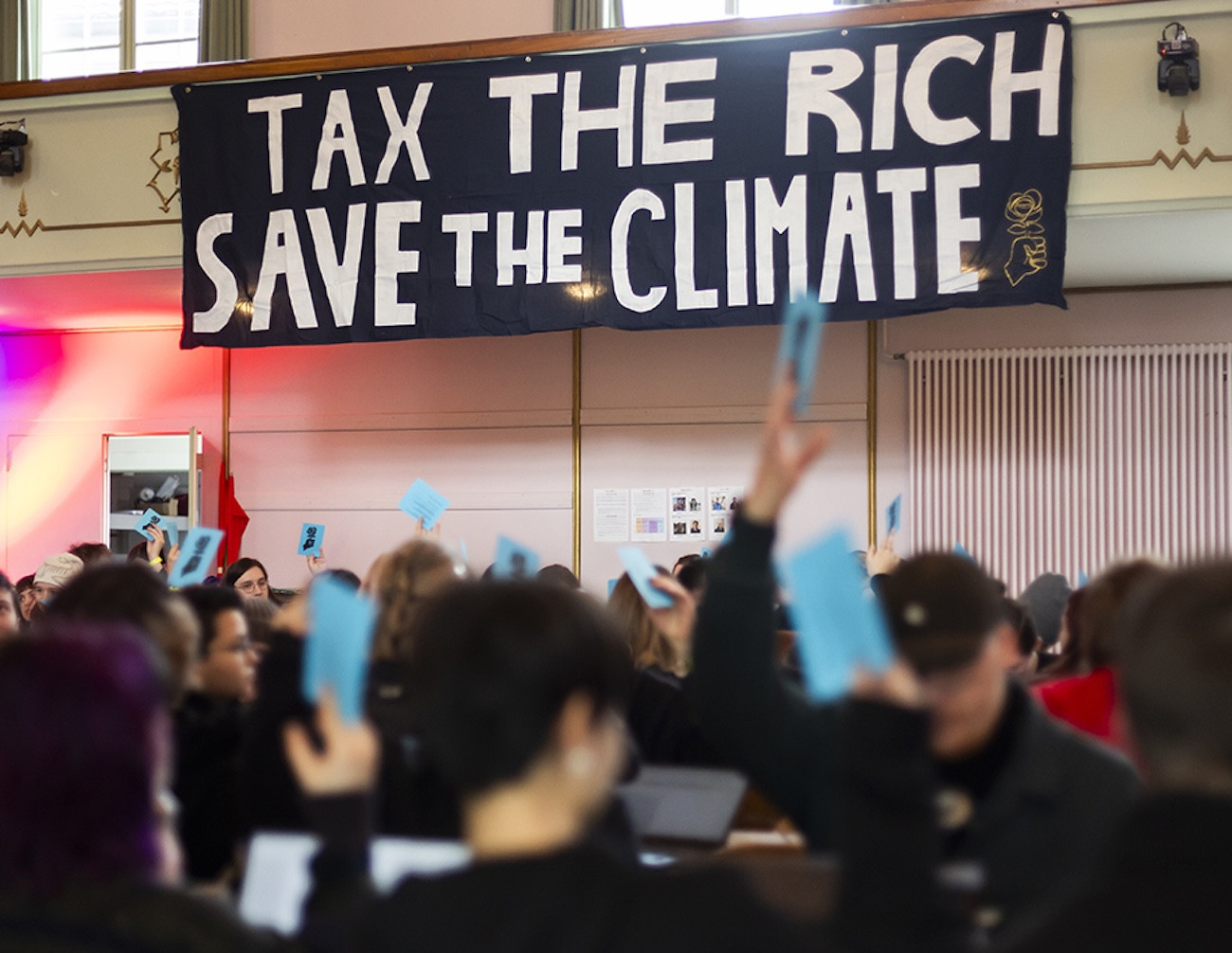Rosa Zukunft ‒ Technik, Umwelt, PolitikKatastrophen: Justiz ist immer auch Klassenjustiz
Niemand hat die Opfer des Morandi-Brückeneinsturzes in Genua korrekt entschädigt. Und niemand wurde nach der Flutkatastrophe im deutschen Ahrtal strafrechtlich verurteilt. Dies, obwohl die Behörden dort geschlampt hatten. Wie jetzt...