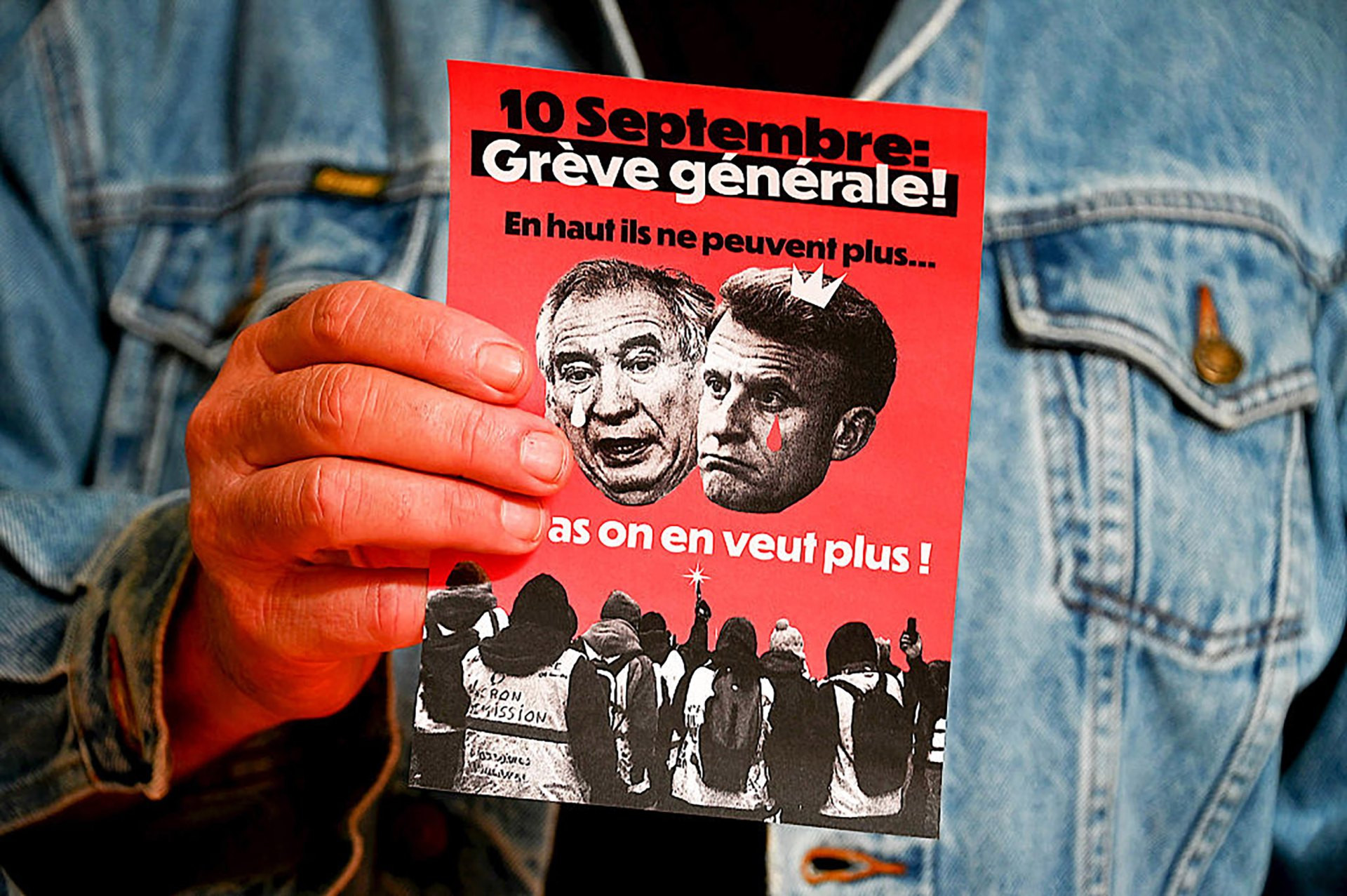Massenproteste für GazaItalien im Ausnahmezustand
Der Völkermord in Gaza schlägt auf Europas Regierungen zurück. Italiens Neofaschistin Giorgia Meloni gerät in Nöte.