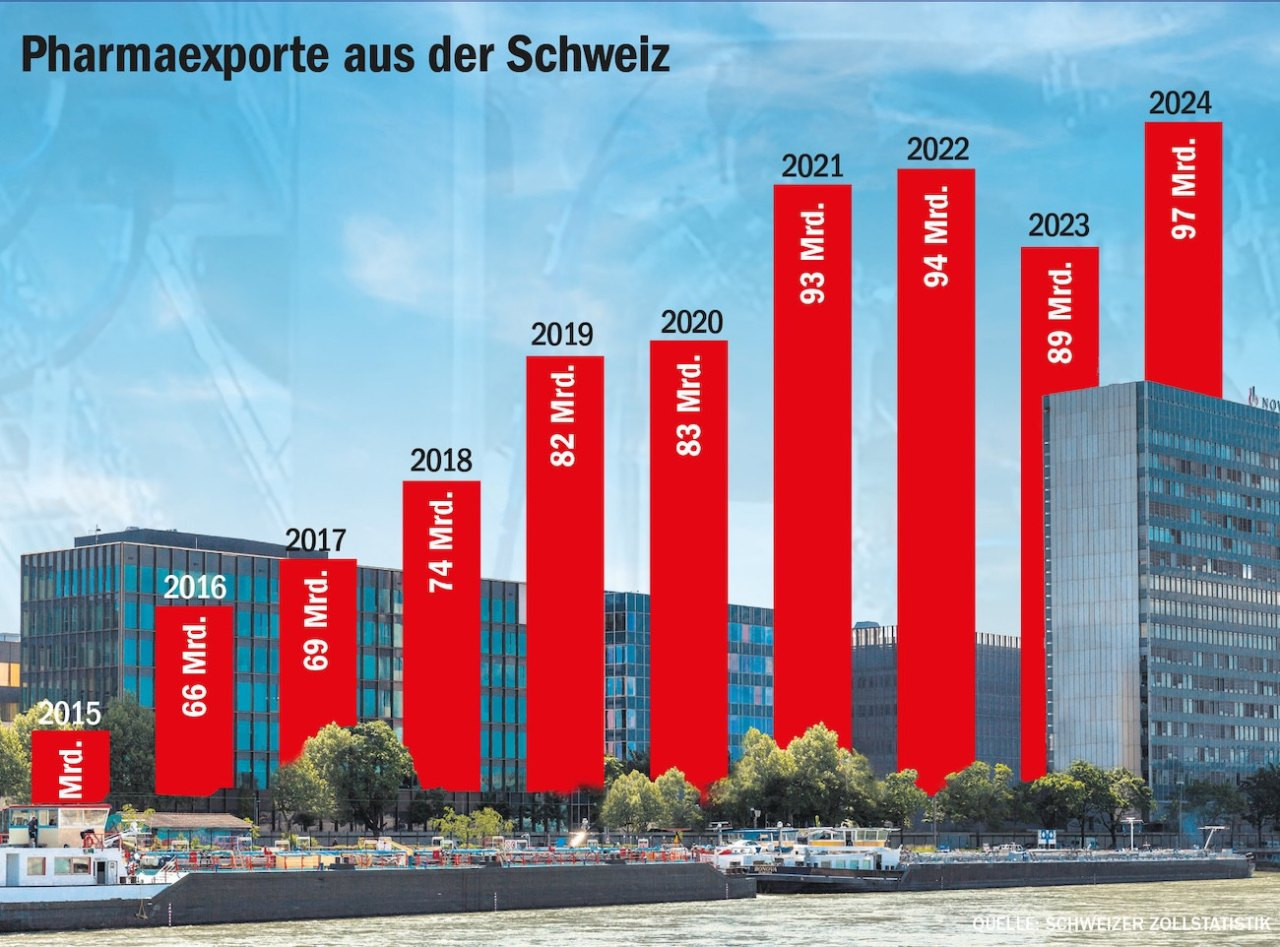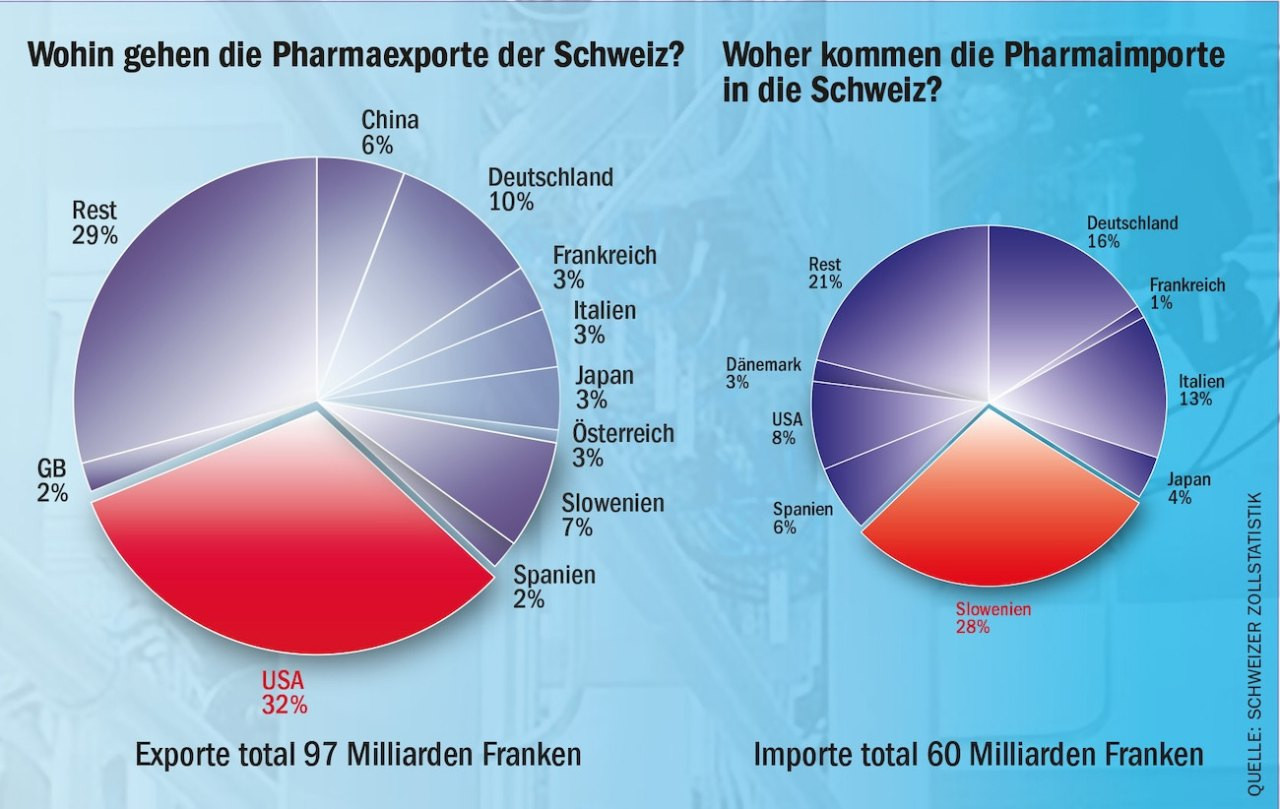Chrampfen muss endlich besser bezahlt werdenSo krass leiden die Kaufkraft und die Gesundheit der Arbeitenden
Die Lohnabhängigen in der Schweiz bekommen immer weniger vom erarbeiteten Wohlstand. Und sie sind immer öfter krank, weil die Arbeitsbedingungen schlechter werden. Die Gewerkschaften wollen das ändern.