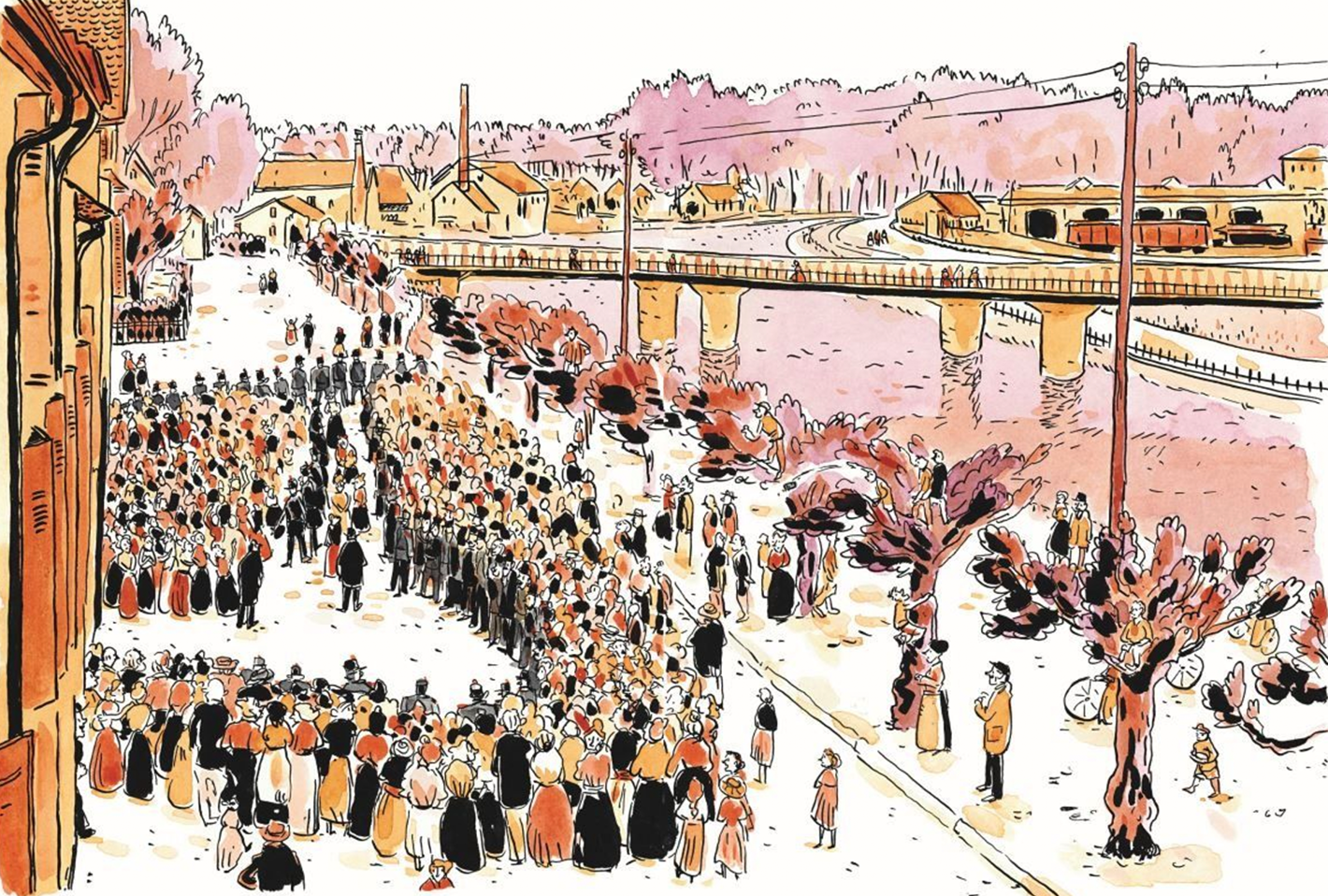Neues Buch über Schweizer PionierinnenMutige Tabu-Brecherinnen
Sie erklommen die extremsten Berge, flogen in schwindelerregenden Höhen oder retteten mit einem Suppentopf-Weitwurf eine Stadt vor dem Verderben. Frauen prägten die Schweiz, doch sie wurden vergessen. Ein neues Buch...