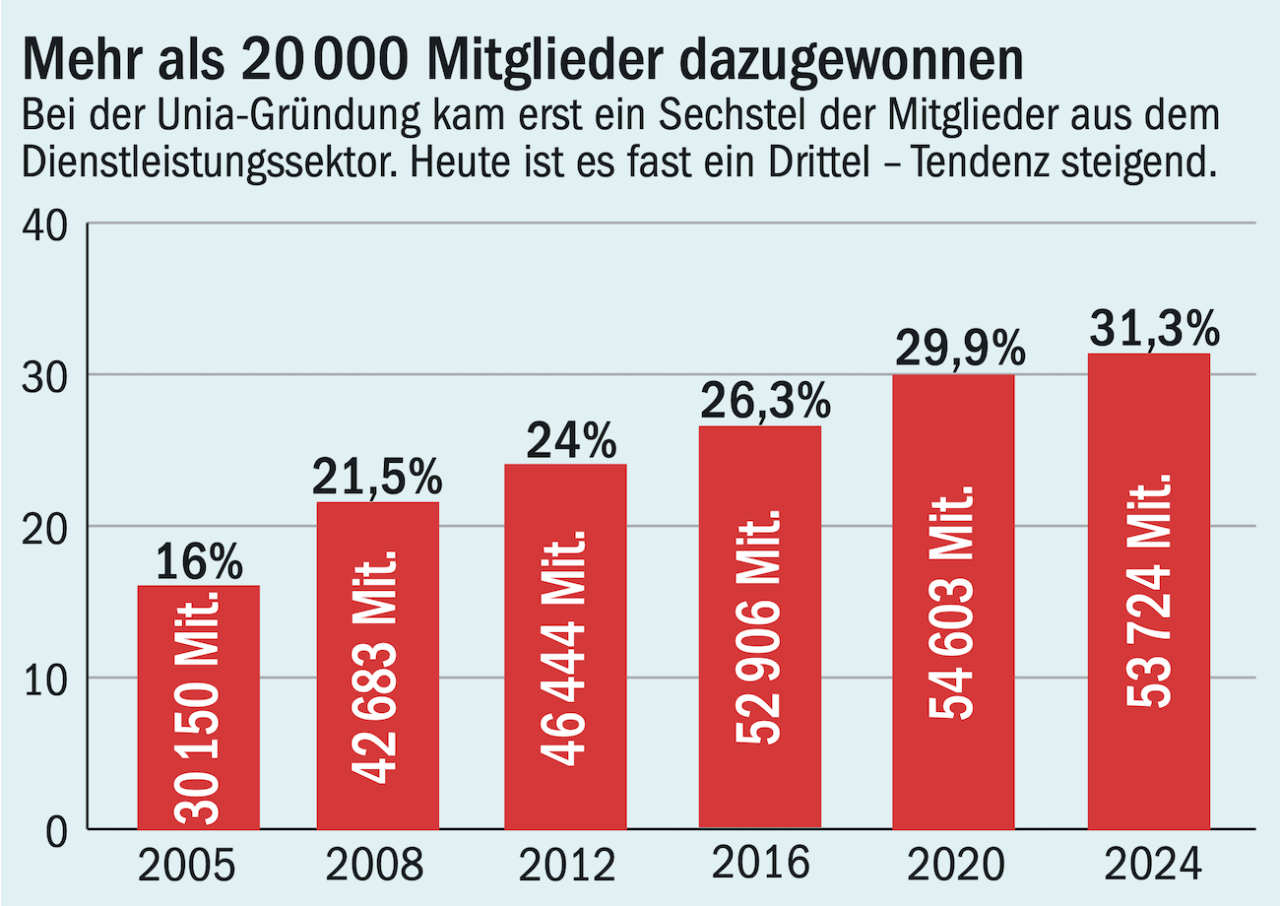Ein Spitzbubentrick?Der neuste Angriff rechter Turbolädeler
Ein liberaler Traum, der auf Teufel komm raus wahr werden soll: Rechte Parteien greifen den arbeitsfreien Sonntag (schon wieder) an. Der neuste Vorschlag kommt vom rechtsbürgerlichen Nationalrat Roger Golay. ...