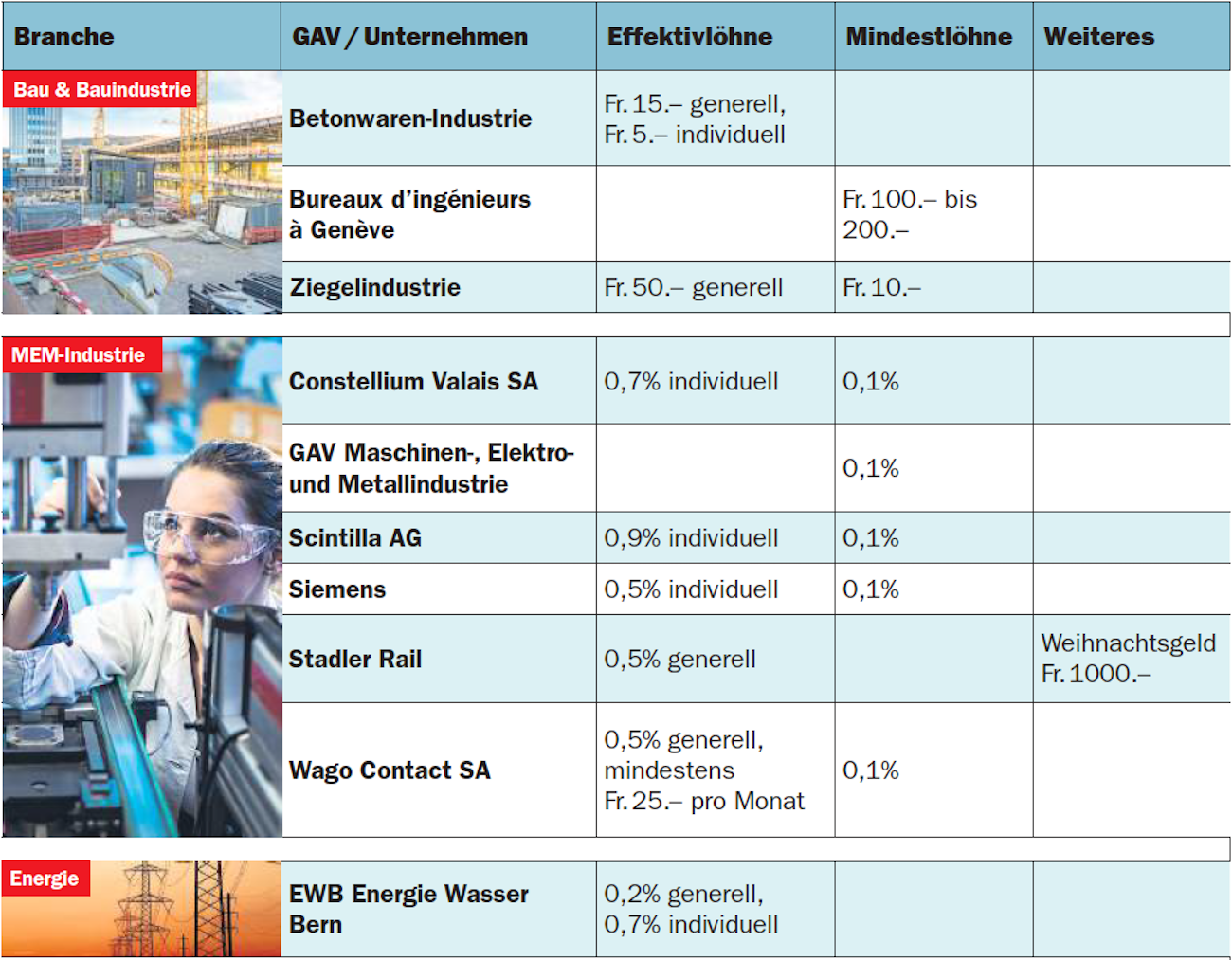Das offene OhrDiskriminierung: «Aus rassistischen Gründen habe ich die Stelle nicht erhalten»
Ich habe mich auf eine Stelle beworben, deren Voraussetzungen ich meines Erachtens alle erfüllt habe.