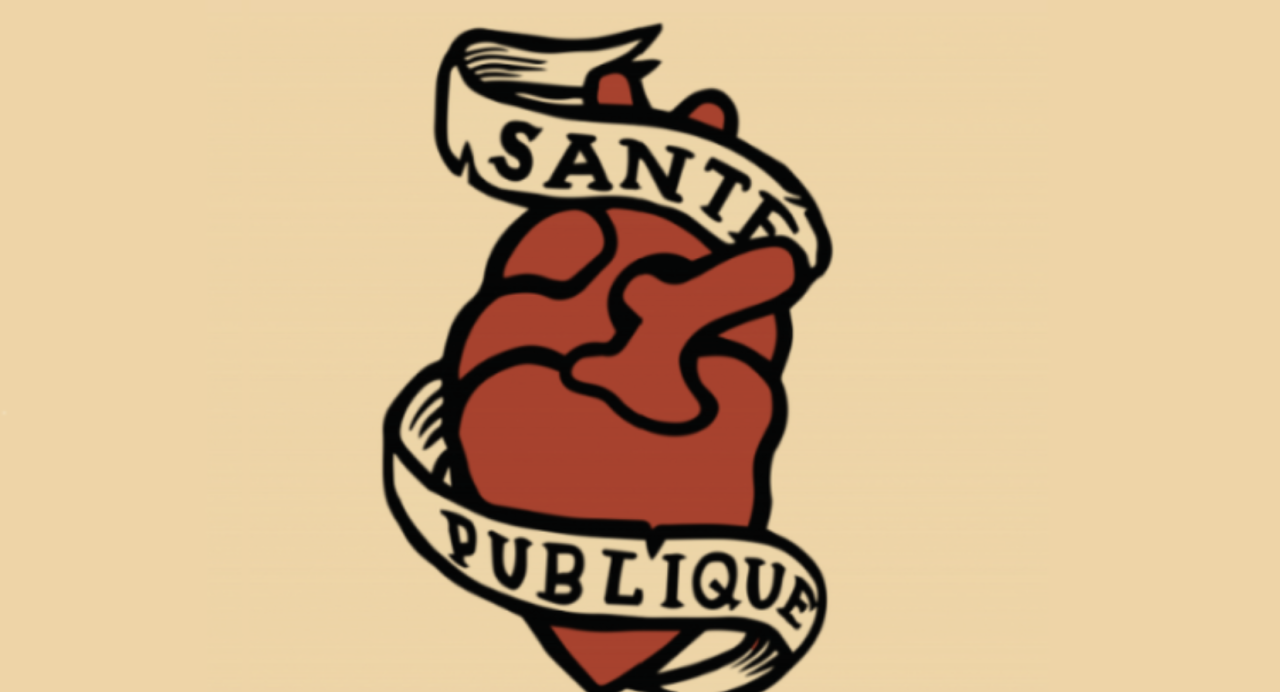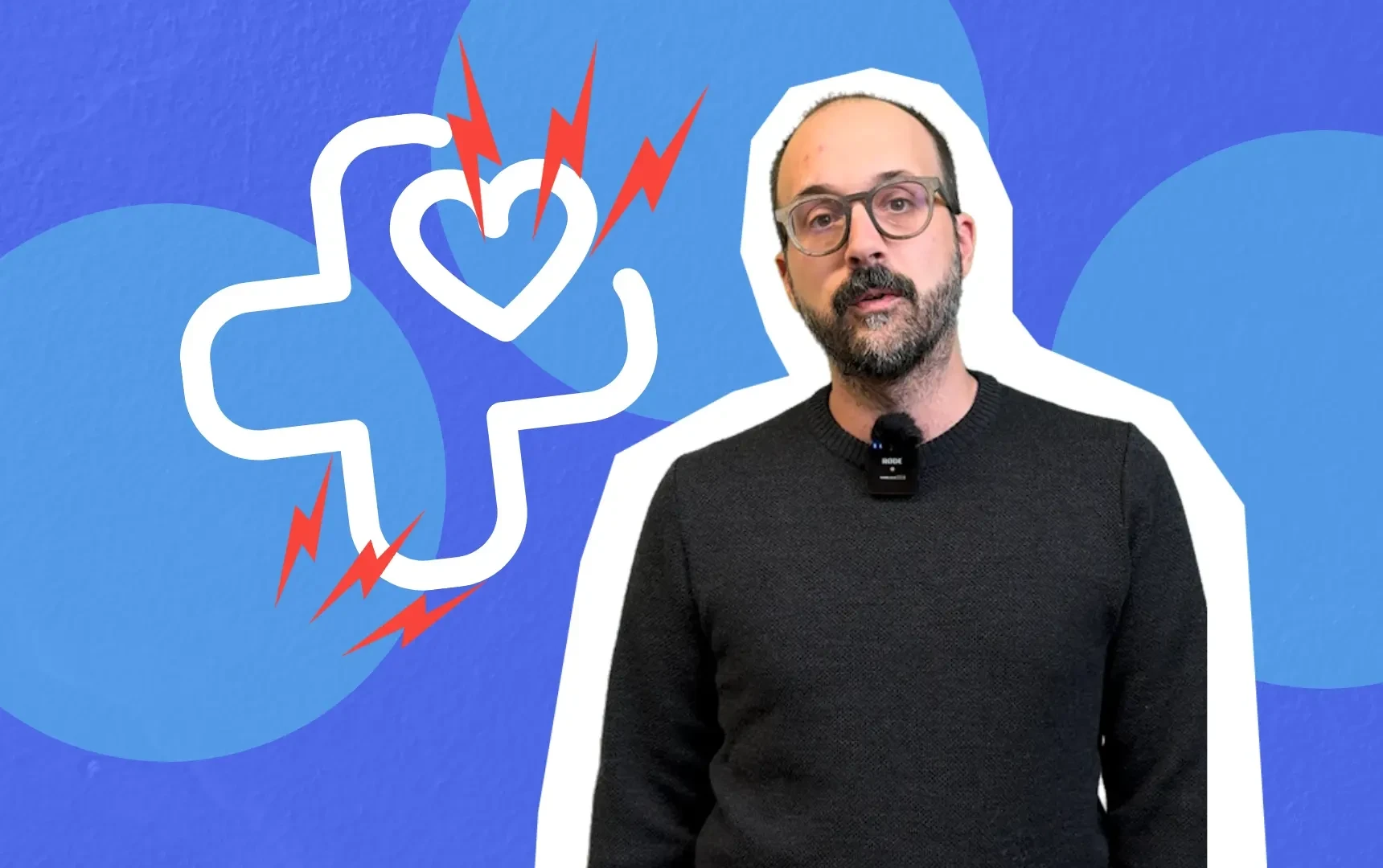Zurück zur MenschlichkeitDas neue Care-Manifest der Unia ist da – und macht Hoffnung
Das neue Care-Manifest der Unia entwirft die Vision einer guten Pflege und Betreuung. Zwei, die daran mitgearbeitet haben, sagen: Das ist kein Wunschtraum. Noch vor 30 Jahren haben wir so...