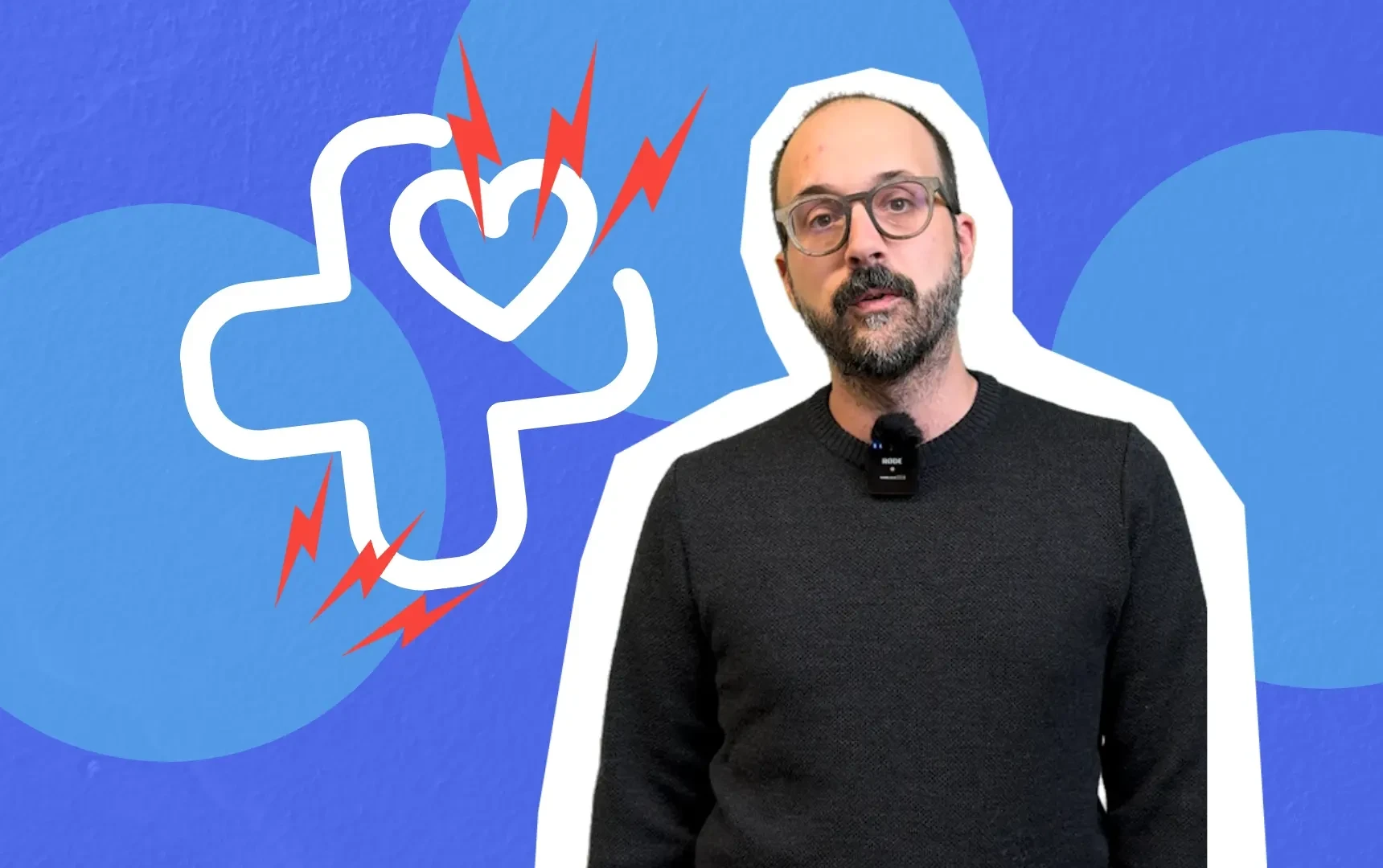work-VideoPflege am Limit: Ein System, das Heime und Pflegende im Stich lässt
Das Schweizer Pflegesystem steht unter Druck und das seit Jahren. Unia-Branchenverantwortlicher Samuel Burri zeigt, warum das kein Zufall ist: Die Pflegefinanzierung wurde falsch aufgesetzt – zulasten von Pflegenden und Bewohnern. https://www.tiktok.com/@unia_schweiz/video/7563325863551339798?lang=de-DE Pflegedemo:...