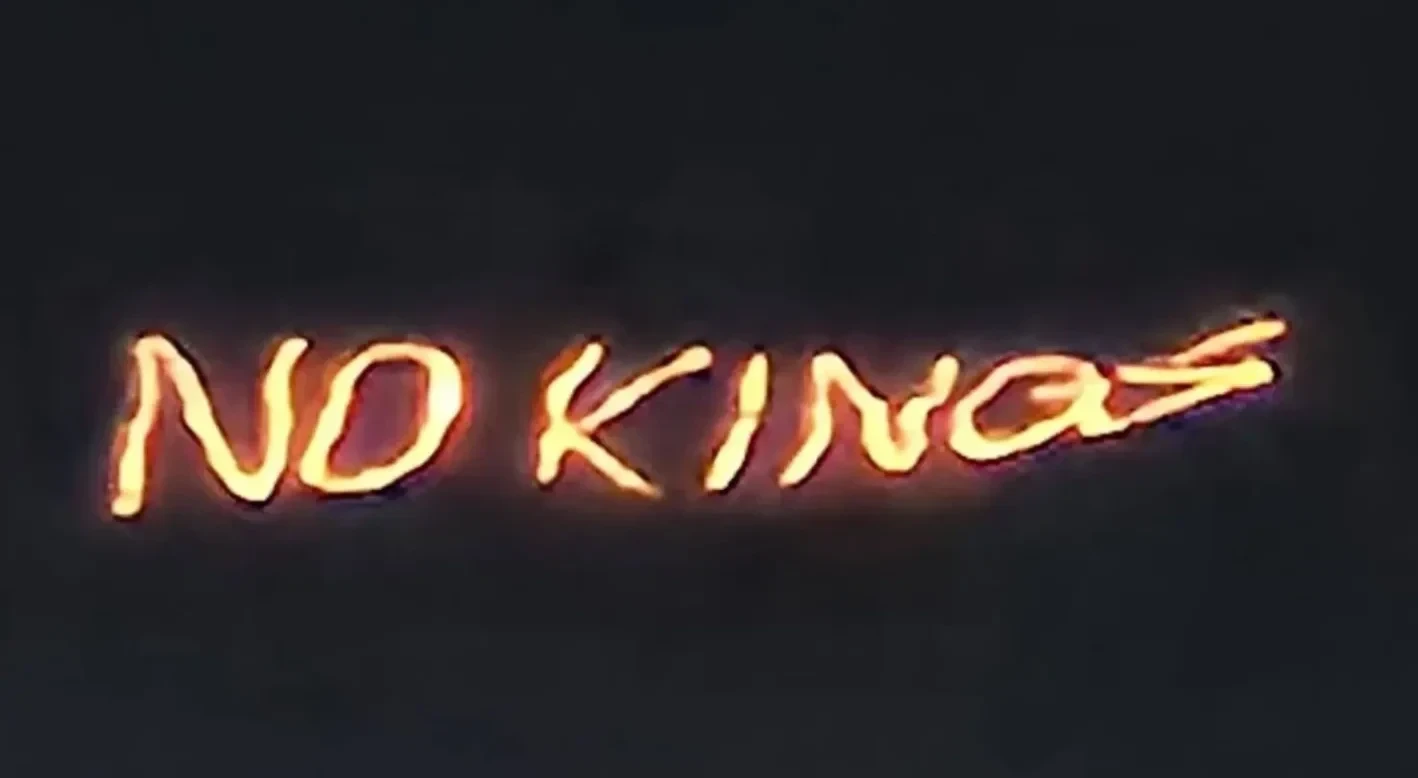Zürcher SanitätskollektivFür fast alle (Not-)Fälle
Das Zürcher Sanitätskollektiv begleitet ehrenamtlich Demonstrationen und andere Veranstaltungen, um in Notfällen schnell und professionell erste Hilfe zu leisten. work hat mit zwei Gründungsmitgliedern über ihre Motivation, die Zusammenarbeit mit...